Aushungern, anketten, in Brand setzen, entblößen: Der eigene Körper ist die letzte, existenzielle Waffe des Protests. Vier Beispiele, wie Menschen mit ihrem Körper Politik machen.
Die Selbstverbrennung: der Körper als Fanal
Wie er da sitzt: den Kopf erhoben, den Rücken durchgedrückt, die Beine im Lotossitz. Als wäre es eine Meditation. Als wären da nicht die Umstehenden, die wimmern und gaffen, beten und niederknien. Als wären da nicht die Flammen, hunderte von Grad heiß, die seinen Körper langsam verbrennen. Der buddhistische Mönch Thích Quảng Đức protestierte im Juni 1963 gegen die Unterdrückung der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit in Vietnam. Helfer übergossen ihn mit Benzin, er selbst entzündete das Streichholz und setzte sich in Brand. Keinen Laut habe dieser Mönch von sich gegeben, notierte ein schockierter Reporter der New York Times. Nach rund zehn Minuten erstarben auch die Flammen. Der Gestank von verbranntem Fleisch lag über dem Platz. Seinen Körper dem Feuer zu übergeben ist seither eines der grausamsten Mittel geworden, um zu protestieren – vor Kirchen, auf Plätzen und in Stadien. Im Oktober 2017 verteilte ein 54-jähriger Pole mitten in Warschau Flugblätter. In harten Worten kritisierte er darauf den anti-demokratischen Kurs der polnischen Regierung; sie müsse gestoppt werden, »bevor sie dieses Land völlig zerstört«. Dann übergoss er sich mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sich an. »Ich hoffe, mit meinem Tod viele Menschen aufzurütteln«, hatte er in einem Manifest geschrieben. Die Selbstverbrennung des tunesischen Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010, mit der er gegen bürokratische Willkür und Polizeigewalt demonstrierte, gilt sogar als Auslöser des Arabischen Frühlings.
Der Nacktprotest: der Körper als politische Plakatwand
Auf dem Wiener Opernball sieht man normalerweise nur Frauen in eleganten Abendkleidern, 2018 aber zeigte sich dort die 26-jährige Femen-Aktivistin Alisa Vinogradova halb nackt. »Poroshenko get the fuck out« stand in schwarzer Schrift auf ihren Brüsten geschrieben, gerichtet an den damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, den Ehrengast beim Opernball. ›Sextremismus‹ nennen die Femen-Frauen ihren Protest. Die ursprünglich in der Ukraine gegründete Organisation will so unter anderem gegen Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt kämpfen. »Unsere Brüste sind unsere Waffen«, sagte Vinogradova nach ihrer Aktion in einem Interview. Mittlerweile agiert Femen nicht mehr von ihrer Zentrale in der Ukraine, sondern von Paris aus. Zum Weltfrauentag im März 2020 liefen rund 40 Frauen mit nacktem Oberkörper und Corona-Masken über den Place de la Concorde, um die Stadt vom »patriarchalen Virus« zu säubern, wie eine der Teilnehmerinnen sagte. Einen etwas anderen Ansatz haben hingegen die sogenannten Slutwalks. Auf den Protestmärschen demonstrieren Frauen teilweise in kurzen Röcken und in Unterwäsche dagegen, wegen aufreizender Kleidung als potenzielle Opfer sexueller Gewalt angesehen zu werden.
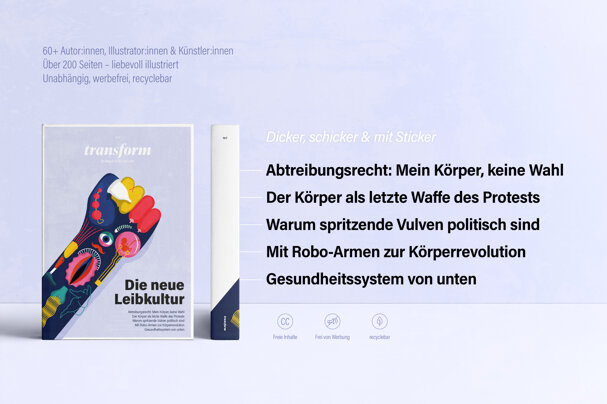
Der Hungerstreik: der Körper als politisches Druckmittel
Zwei Prozesse, mehr als 30 Jahre Haft und 148 Peitschenhiebe: Das ist das Ergebnis, wenn man im Iran für Menschenrechte eintritt – wie es die Anwältin Nasrin Sotudeh seit Jahren tut. Wegen ihres Einsatzes für Frauen und zum Tode Verurteilte wurde die 57-Jährige vom Regime in Teheran schon lange verfolgt und schließlich 2019 zu einer drakonischen Strafe verurteilt. Im Sommer 2020 begann Sotudeh einen Hungerstreik im berüchtigten Evin- Gefängnis, aus Protest gegen die Bedingungen, unter denen politische Gefangene dort eingesperrt sind. Bis auf 47 Kilogramm Gewicht hungerte sie sich herunter, dann brachte man sie mit einer Herzschwäche ins Krankenhaus. Wenige Wochen später erhielt Sotudeh den Alternativen Nobelpreis. Der Streik von Ebru Timtik, einer Anwältin in der Türkei, dauerte hingegen 238 Tage – und endete mit ihrem Tod. In Istanbul war sie 2019 wegen Terrorvorwürfen zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt worden. Um einen fairen Prozess zu bekommen, hörte sie auf zu essen, nahm nur noch Vitamine und Flüssigkeit zu sich. Am Ende ihres Lebens wog sie 30 Kilogramm. Ein Anwaltskollege, der mit ihr in den Hungerstreik getreten war, wurde nach ihrem Tod freigelassen.
Die Sitzblockade: der Körper als Hindernis
Man muss mit dem Körper oft gar nichts Besonderes anstellen, um ihn als Waffe zu nutzen. Es reicht, wenn man ihn dem Gegner einfach in den Weg stellt. Ob es um die Rodung von Waldstücken, die Räumung besetzter Häuser oder um Atomtransporte geht: Schon eine sitzende Menschenmenge kann es der Polizei schwer machen, ihre Autorität durchzusetzen. Umso mehr natürlich, wenn diese Menschen sich anketten. Bei den Castor-Transporten etwa mussten immer wieder Vertreter:innen der Anti-Atomkraft-Bewegung mit Schweißgeräten, Meißeln und Sägen von Betonpyramiden und Gleisen gelöst werden. Im Dannenröder Forst in Hessen, kurz ›Danni‹ genannt, protestierten Waldbesetzer:innen im Herbst 2020 gegen den Weiterbau der A49. Viele harrten in Baumhäusern aus, andere ketteten ihre Arme an einbetonierte Stahlrohre oder kletterten ungesichert durch die Bäume. Mit sogenannten Höheninterventionsteams, Baggern, Schlagstöcken und
Pfefferspray gelang es der Polizei schließlich, den politischen Hochseilgarten zu räumen.
Text: Max Beckerson
Foto: JospehParis on Wikimedia
Weiterlesen
198 Methoden zur gewaltfreien Revolution
Gene Sharp, Politikwissenschaftler und Gründer der Albert Einstein Institution in Boston, hat 1973 eine Liste mit 198 Methoden zusammengestellt, wie durch gewaltfreie Mittel Protest ausgeübt werden kann. Darunter finden sich Protestformen mit dem Körper, und noch viele weitere Ideen.
tfmag.de/novio | aeinstein.org
Handeln
Besuche ein Aktionstraining
Viele Protestbewegungen wie Ende Gelände oder Gruppen wie Sand im Getriebe bieten sogenannte ›Aktionstrainings‹ für Interessierte an. Darin lernst du, wie du deinen Körper optimal als Blockade einsetzt, allein oder in der Gruppe. Wem das noch nicht reicht: Es gibt auch Fortgeschrittenenkurse für Anketten oder Festkleben.
Lass dir ein Tattoo stechen
Auch Körperkunst kann politisch sein. Setze zum Beispiel ein Zeichen für Menschenrechte, indem du dir ein Tattoo stechen lässt. Die Bewegung ›Human Rights Tattoo‹ fährt durch die ganze Welt und vergibt Tattoos mit einzelnen Buchstaben, stellvertretend für einen Artikel der Menschenrechte. Wenn du selbst keines möchtest, kannst du auch einfach für die Aktion spenden.
humanrightstattoo.org




