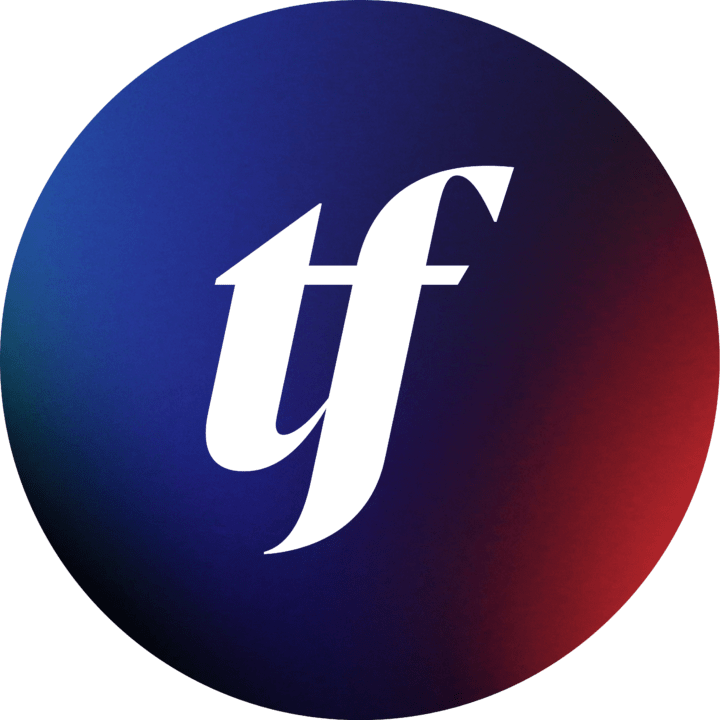Richtig, wir verlagern die synthetische Chemie ins Wasser. Zugegeben, das hört sich zunächst verrückt an, aber es ergibt Sinn. Seit Beginn der Industrialisierung sind unsere chemischen Arbeitstechniken nicht ausreichend auf Umweltverträglichkeit geprüft worden.
Organische Lösemittel sind nahezu unverzichtbar in der synthetischen Chemie, denn in ihnen lösen sich die meisten organischen Moleküle. Gleichzeitig machen Lösemittel 80 Prozent des chemischen Abfalls aus und sind meist nicht nur hochgradig toxisch, sondern auch erdölbasiert – und Erdöl ist nicht gerade die Ressource der Zukunft. Dabei könnte alles so viel besser sein, wenn wir uns ein Vorbild aus der Natur nehmen würden. Eine umweltverträglichere, synthetische Chemie der Zukunft setzt daher auf Wasser als Lösemittel. Es bedarf lediglich ein paar innovativer Einfälle.
„Die kochen auch nur mit Wasser…!“ Natürlich haben wir im Chemiestudium über diesen Satz geschmunzelt. Bietet die Chemie neben Wasser doch vielfältigste Lösemittel, wie beispielsweise Tetrahydrofuran, Chloroform oder Pyridin. Letzteres ist unverkennbar durch seinen fürchterlichen Geruch nach stinkendem Fisch. Daher gilt nach wie vor: Chemie ist’s, wenn‘s kracht und stinkt. Die Wissenschaft, in der die Stoffe A und B zu Verbindung C reagieren – und das meist in gelöstem Zustand.
Chemische Synthese: Die Zusammenführung von Stoffen. Was ist das überhaupt? Nun ja, es ist Kunst. Ausgefuchste Eleganz. Reinste Ästhetik.Verfolgt man wissenschaftliche Vorträge von Chemiker*innen, die Naturstoffe synthetisieren, könnte man meinen, dass es tatsächlich eine Nebenbeschäftigung von Pablo Picasso oder Niki de Saint Phalle gewesen sein müsste. Ist das Wort Chemiker*in dann filigran genug? Nein, wir sind molekulare Architekten! Kreativschaffende im Nanoraum! Erdeflüsterer. Genau deshalb sind wir berufen die chemische Synthese der Zukunft nachhaltiger zu gestalten: mit Tricks aus der Natur. Aber lasst uns einen kurzen Ausflug in die Naturstoffsynthese unternehmen, um zu verdeutlichen, wie konventionelle Chemie bisher gedacht wurde.
Der Naturstoff Taxol – eine Erfolgsgeschichte in der Krebstherapie
Naturstoffe sind Biomoleküle mit oftmals bemerkenswerter biologischer Aktivität. Ein berühmtes Beispiel dieser Gruppe ist Taxol, das in der Rinde der pazifischen Eibe Taxus brevifolia vorkommt. Ein einzigartiger Wunderstoff, der sogar Krebs bekämpft. In der Chemotherapie gibt es wenige Moleküle, die vergleichbare potente Eigenschaften besitzen. Doch die natürlich verfügbaren Mengen solcher Wirkstoffe wären meistens viel zu gering, um den Bedarf der Medizin zu decken. Deshalb kommen die molekularen Architekten ins Spiel und kreieren einen synthetischen Bauplan für die Großproduktion. In diesem speziellen Fall eine Mammutaufgabe, aber die große Nachfrage nach Taxol rechtfertigt jeden Aufwand.
Die erste Synthese von Taxol gelang einem US-Forscherteam um Kyriacos Nicolaou im Jahre 1994. Das wurde über Nacht mit dem Deckblatt der renommierten Fachzeitschrift Nature belohnt, was einem Ritterschlag gleichkommt [1]. Die Forscherwelt wertschätzte dementsprechend, wie schwierig bis unmöglich solche komplexen chemischen Strukturen im Labor nachzukochen sind (so nennt man in der Chemie, wenn man liebt, was man tut). Welcher Zusammenhang besteht jedoch zwischen der Taxolsynthese und Nachhaltigkeit? Organische Lösemittel! Fast in jedem Arbeitsschritt werden sie benötigt.
Ein Paradigmenwechsel muss her
Die Methoden und Werkzeuge, um chemische Produkte zu entwickeln, sind ohne Frage prächtig und vielfältig. Doch die große Bedeutung chemischer Erzeugnisse für die Wirtschaft und unseren Alltag hat ihre Kehrseite. Wer in den 70er Jahren im Rhein baden wollte oder heute im Jangtsekiang, der weiß, dass der sorglose Umgang mit chemischen Abfällen unsere Umwelt massiv belasten kann. Etwa wenn diese in unsere Gewässer gelangen. Der Jangtsekiang ist Chinas längster Fluss, fließt durch 186 Städte und droht nach jahrelanger Verseuchung umzukippen – fällt also aus dem biologischen Gleichgewicht. Mit der Gewissheit, dass Trinkwasser ohnehin bald knapp wird, ist die Umweltverschmutzung durch die chemische Industrie umso kritischer zu bewerten. Wie schaffen wir es, die Chemie von unserem teuren Gänsewein fernzuhalten?
Richtig, wir verlagern die synthetische Chemie ins Wasser. Zugegeben, das hört sich zunächst verrückt an, aber es ergibt Sinn. Seit Beginn der Industrialisierung sind unsere chemischen Arbeitstechniken nicht ausreichend auf Umweltverträglichkeit geprüft worden. „If successful, at what cost to the environment?“ sagt man im angelsächsischen Raum (sofern erfolgreich, zu welchem Preis für die Umwelt?). Hat man die Auswirkungen organischer Lösemittel auf die Umwelt zu lange heruntergespielt?
Für die Industrie kann es gleichzeitig sogar kostengünstiger sein grün zu produzieren, weil eine teure Schadstoffentsorgung reduziert wird oder gänzlich entfällt (z.B. Müllverbrennung oder Endlagerung auf Deponien). Wasserstoffperoxid ist ein grünes Beispiel. Das bekannte Bleichmittel wird in chemischen Reaktionen gerne verwendet, da seine Abbauprodukte lediglich aus Wasser und Sauerstoff bestehen. Selbstverständlich gibt es von staatlicher Seite eine Regulierung der Chemikalienzulassungen, um einen Mindestschutz für Mensch und Umwelt zu garantieren. In Europa spielt die Chemikalienverordnung REACH eine entscheidende Rolle (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Diese fordert von Chemieunternehmen eine kritische Auseinandersetzung mit potenziellen Gefahren ein und überprüft, ob unerlässliche Standards eingehalten werden. Dennoch: organische Lösemittel sind nach wie vor überall vertreten.
Innovative Lösungen für eine umweltverträgliche Chemie kann die Forschung bereitstellen. Diese wird jedoch in vielen Fällen eher für hohe Reaktionsausbeuten belohnt und weniger für die grüne Evaluierung von Lösemitteln, toxischen Katalysatoren oder der Energiefrage.
Ein Preis, der viel Hoffnung in fundamental neue Entwicklungen setzt
Dass es auch anders geht, zeigt der Nobelpreis 2018 für Chemie an die US-Amerikanerin Frances Arnold (neben George Smith und Gregory Winter). Sie ist Professorin für Biochemie am berühmten California Institute of Technology (Caltech) und gleichzeitig erst die fünfte Frau in der Geschichte, die diesen Preis erhielt. Diese hohe wissenschaftliche Auszeichnung wurde unter anderem für die Erforschung und Anwendung von gerichteter Evolution vergeben [2]. Das Entscheidende: die Chemie findet komplett in Wasser statt. Zusammen mit bioabbaubaren Materialien.
Natürliche Evolution ist nicht gerichtet. Hier sind Prozesse durch Zufall und natürliche Selektion gesteuert – ohne erkennbares Ziel. Anders als bei der neuen Technologie von Arnold. Hier wird ein Ziel von außen vorgegeben: z.B. die Optimierung von bereits existierenden Biokatalysatoren, sogenannten Enzymen. Enzyme gehören zu den mächtigsten Arbeitstieren der Schöpfung. Sie ermöglichen reichhaltige chemische Reaktionen in Zellen, wie zum Beispiel die Photosynthese. Alles in Wasser!
Jetzt sollen ausgewählte Enzyme noch effizienter werden und vor allem neue Fähigkeiten erwerben können [3]. Die Natur würde für den evolutorischen Optimierungsprozess Jahrtausende benötigen. Mit Arnolds neuer Technik sind es nur noch Wochen bis Monate. Mittlerweile sind Enzyme kreiert worden, die eine Reihe von unnatürlichen chemischen Reaktionen katalysieren können. Bestimmte Medikamente gegen Krebs- und Autoimmunerkrankungen lassen sich nun umweltschonender herstellen – ebenso wie Biokraftstoffe und umweltfreundlicheres Plastik (auf der Basis von natürlichen Zuckern).
Think outside the box!
Die Integration von enzymatischen Reaktionen in die synthetisch organische Chemie wird in Zukunft weiter zunehmen. Da diese Strategie aber auch komplex und aufwändig sein kann, wird es nicht die einzige Alternative für mehr grüne Chemie darstellen [4]. Der Grund für die umweltbelastende Verwendung von organischen Lösemitteln ist schlicht einfach der, dass sich organische Stoffe in Wasser nicht lösen oder schlimmer: damit reagieren. Deshalb bedarf es ein paar Tricks. Bruce Lipshutz ist Chemieprofessor an der University of California in Santa Barbara (UCSB) und beschäftigt sich seit über 20 Jahren damit, wie die Wasserchemie der Zukunft aussehen könnte [5]. Sein Vorschlag: organische Tensid-Nanopartikel.
Wenn das Molekül nicht in Lösung kommt, dann muss die Lösung zum Molekül kommen
Tenside, bekannt aus Waschmitteln, haben jeweils eine hydrophile (wasserliebende) und eine lipophile (fettliebende) Seite. Im wässrigen Medium ordnen sie sich zu winzigen Klümpchen an, sogenannten Mizellen. Diese sind mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar. Ein bekanntes Beispiel von Lipshutz ist das leicht modifizierte Molekül Vitamin E. Absolut umweltverträglich. Löst sich ein organisches Molekül nicht in Wasser, dann diffundiert es einfach in die Vitamin-E-Mizelle. Gibt man weitere Reaktanden in die Seifenlösung, können in der eingekapselten Mikroumgebung Reaktionen stattfinden. Das Vorgehen ähnelt der Natur, die dafür halbdurchlässige Zellmembranen nutzt.
Lipshutz hat eindrücklich gezeigt, wie kompatibel dieser neue Ansatz gegenüber konventioneller Chemie sein kann [6]. Bestimmte Reaktionen laufen in Wasser sogar oftmals besser oder überhaupt erst ab. Hervorzuheben sind auch die milden Bedingungen (Raumtemperatur, keine ätzenden Substanzen), mögliches Recycling des Reaktionsmediums und die äußerst reduzierten Mengen an Metallkatalysatoren (um 1-2 Größenordnungen), die diese Vorgehensweise auszeichnen. Natürlich besteht weiterhin Verbesserungsbedarf und bislang ist die Lipshutz‘sche Chemie auf ausgewählte Anwendungen limitiert. Doch der aktuelle Nobelpreis beweist, dass der Glaube an ein starkes Innovationspotential in diesem Feld existiert.
Das zu Beginn erwähnte Biomolekül Taxol ist in diesem Zusammenhang ein mutmachendes Beispiel. Denn es wird heute industriell über einen halbsynthetischen Ansatz gewonnen. Erst wird eine vielversprechende Vorstufe biosynthetisch in Wasser gewonnen und zuletzt im Labor veredelt. Dieses Vorgehen hat die Marktreife von Taxol als Medikament ermöglicht. Die Natur bietet entscheidende Lösungsansätze für eine nachhaltigere chemische Produktion der Zukunft – als Kreativschaffende im Nanoraum gilt es für Chemiker*innen, diese nicht nur weiterhin zu erforschen, sondern industriell auch nutzbar zu machen.

Autor: Clemens Dialer ist Chemiker (M.Sc.) aus München und findet kleine Moleküle richtig klasse. Mit diesen lassen sich viele kreative Ideen spinnen.

Illustrator: Nicola Ferrarese ist freier Illustrator und lebt in Treviso (Italien).
______________________________________________________________________________________