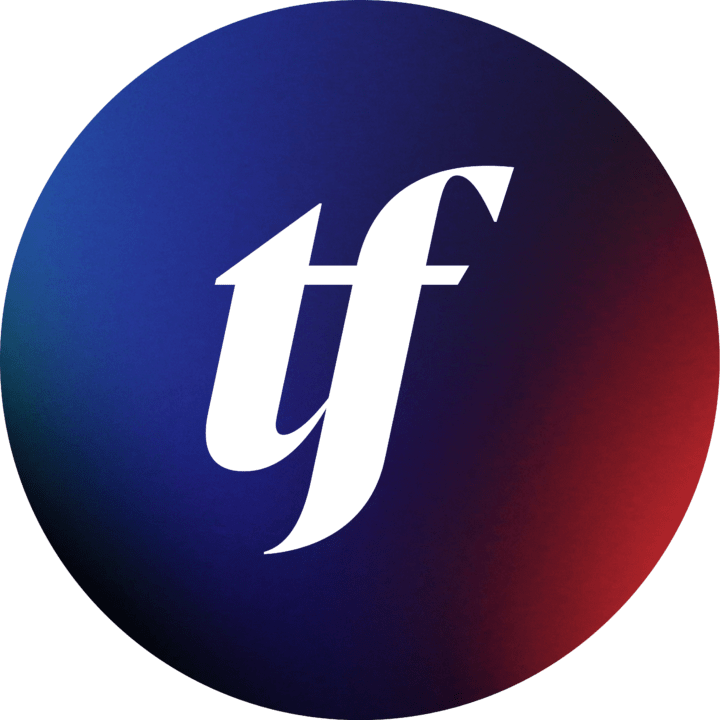Ich befinde mich in der Universität Leipzig. Der Vorlesungsraum ist brechend voll, das Publikum äußerst gemischt. Vor uns sitzen drei Personen, eine von ihnen trägt einen Anzug und einen auffallend gepflegten Haarschnitt. Das verwundert sehr, denn die degrowth Konferenz besticht durch einen eher hippiesken look ihrer Teilnehmer*innen. Mit dem Kontrast zu Dreads und Jogahosen will hier jemand offensichtlich provozieren.
„Anleitung zur Karriereverweigerung“ als Titel einer Vorlesung scheint einen Nerv zu treffen, der alles andere als abschreckt und vielmehr durch alle verschiedenen Gruppierungen hindurch auf gewaltiges Interesse stößt. Stakkatoartig liest der Mann im Anzug eine Aufzählung von Krisen vor. „Klimakrise, Finanzkrise, Ich-Krise, Krisen-Krise…“ – die drei Personen vor uns beginnen zu schreien. Einer von ihnen ruft uns auf, es ihnen gleichzutun. Nun schreien wir alle. In meinen Augen sammeln sich kleine Tränchen. Ich bin nicht allein. Niemand scheint allein zu sein.
Was darauf folgt ist ein Videoausschnitt aus Deichkinds „Bück Dich hoch!“. Die Stimmung ist gemischt und die Erwartungen sind hoch: bekommen wir jetzt hier tatsächlich eine Anleitung, wie wir uns dem Druck zur Karriere, zur Selbstmaximierung und der damit einhergehenden Sicherheiten, widersetzen können?
Alix Faßmann, Autorin eines Buches mit gleichem Titel wie dem der Vorlesung und zwischen zwei den Typen auf dem Tisch vor uns sitzend, beginnt vorzulesen. Das Kapitel „Arbeit macht arm“ bringt durch Thesen wie „workaholics sind laut einer Studie in ihren kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt“ Teile des Publikums zu erstem vorsichtigem Gelächter. Weiter geht’s mit Leiharbeit, die als „Sklavenarbeit des 21. Jahrhunderts“ beschrieben wird. Der Grund: jeder Zehnte dieser „working poor“ muss beim Arbeitsamt aufstocken. Unsere Gesichter werden etwas blass. Die „Angst vor dem Abstieg“ zwinge viele zu einem Mittelstandsleben auf Pump, gerade zur Weihnachtszeit. Ganze 6,5 Millionen Menschen in Deutschland sollen schon überschuldet sein. Das sind mehr als es Arbeitslose gibt. Im Publikum schauen sich die Leute um, manche wollen schon wieder schreien.
Doch es wird unerbittlich weitergelesen. Nächstes Kapitel: „Arbeit macht krank.“ Dort beschreibt die Autorin eine Zuspitzung des Phänomens, das sich durch das japanische Wort „karoshi“ ausdrückt. Wörtlich bedeutet es: Tod durch Überarbeitung. In einer tradionellen Leistungsgesellschaft wie der Japans ist das tatsächlich keine Seltenheit und wie so oft hat der asiatische Tiger wohl auch hier weltweite Trends vorherbestimmt. Aber Japan wäre nicht, was es ist, wenn auch dieser Fall nicht auf perfide Art und Weise bürokratisiert wäre: Entschädigungszahlungen für die Familie werden erst fällig, wenn der Betroffene mindestens 100 Überstunden gesammelt hatte. Und in der Regel versuchen die japanischen Angestelltem dem Problem zu begegnen, indem sie sich ihre Urlaubstage für den Krankheitsfall aufsparen.
Doch weit weg von unserer Realität ist die Gefahr keineswegs: auch hier in Europa gibt es Tote durch Überarbeitung. Der letzte breitdiskutierte Fall war der von Moritz, einem Praktitkanten im Londonder Bankenviertel, der seine Epilepsie verschleppte als er mal wieder ganze Nächte im Büro verbrachte. In den Zeitungen dazu gab es viele Beileidsbekundungen. Und immer wieder: deutliche Anerkennung für seine Arbeitsleistung.
Und was machst Du so?
Die drei fragen ins Publikum: was ist denn eigentlich Arbeit?
Vereinzelte melden sich: „Verpflichtung!“ ; „Berufung!“. Jemand fragt, ob denn Lohnarbeit gemeint sei, denn es gäbe ja auch Arbeit, die Spaß macht. Der Mann vor uns auf dem Tisch, nicht der im Anzug, sondern der mit dem Vollbart, entschließt sich die Frage umzudrehen. „Was ist Arbeit denn nicht?“
„Muße.“; „Selbstbestimmt.“
Es folgt ein fiktives Bewerbungsgespräch der beiden Männer über Alix in der Mitte des Tisches hinweg. Der Mann mit Vollbart fragt: „was wäre, wenn ich mich bei Ihnen bewerbe, ohne, dass ich es nötig habe?“ Der Anzugträger erwidert: „Warum sind sie dann hier, Sie haben sich doch beworben!“ – „Aber Sie brauchen doch jemanden, der für sie arbeitet, oder nicht?“
Die Situation scheint vertrackt. Eine Einigung zwischen den beiden ist vorerst nicht greifbar, das Gespräch wird zunächst abgebrochen.
Zwischenfrage ins Publikum: „Können wir ohne Zwang überhaupt produktiv sein?“
Dies lässt sich von dieser Frage aus dem scheinbaren Nichts keineswegs aus der Fassung bringen und poltert entschlossen mit Gegenfragen: „Müssen wir produktiv sein?“ – aber auch: „Wir wollen doch produktiv sein!“ und „Wir haben physische Zwänge, wie Hunger!“
Doch die Diskussion wird nicht vertieft, es geht schon wieder weiter. In Anlehnung an ein Buch von Patrick Spät mit dem Titel „Und, was machst Du so?“ sind die beiden Männer in eine weitere Konfliktsituation verwickelt. Auf die selbige Frage des Anzugträgers antwortet der Bärtige sinngemäß mit seiner Existenz, also dass er ja einfach lebe. Das Spiel geht über Fragen wie der Altersvorsorge und der Familie schlußendlich auf Gegenattacken über wie etwa: „Hälst Du Dich für moralisch glaubwürdig?“. Im Publikum gibt es hämisches Gelächter.
Immer wieder reißen die drei uns von einer Frage, einer Information, zur Nächsten. Wir sollen nicht durchatmen können. Wir sollen ihren vermeintlich roten Faden nicht erkennen können und allmälich dämmert es jedem: eine Schritt für Schritt Anleitung im klassischen Sinne, also einen einfachen Weg zur Karriereverweigerung bekommen wir hier nicht aufgedeckt. Vielmehr eröffnet sich uns ein Blick in die Abgründe dessen, worüber die meisten im Raum sich ohnehin einig sind: Arbeit ist nicht per sé gut. Schlecht ist sie auch nicht unbedingt, das muss sie jedenfalls nicht sein. Die Auswüchse unserer entfesselten Leistungsgesellschaft und der entmenschlichten, schlechtbezahlten Arbeit – die sind es aber schon. Und zwar ziemlich.
Alix schlägt ihr Buch wieder auf. Es geht weiter mit dem nächsten Kapitel: „Wachstum macht ungleich.“ Darin geht sie auf die Annahme von „Merkel und verschiedenen Managern“ ein, die besagen, dass „Menschen wie Tiere sind“ und dementsprechend der Selbstzweck im Grunde nur natürlich und wenig verwerflich sei. Maximales Geld, maximaler Erfolg, maximale Macht und maximaler Sex. Scheint auch einleuchtend, denn wohl niemand im Publikum kann sich einen Bären vorstellen, der aus gesellschaftlicher oder ökologischer Rücksicht auf ein Kaninchen verzichten würde. Aber der Chef von der Deutschen Bank? Hat der wirklich soviel verdient? Alix weist darauf hin, dass Kritikern nicht selten unterstellt würde, sie „seien ja nur neidisch“.
Auch dieser Gedanke wird nicht sacken gelassen. Es folgt ein Film der schweizerischen Initiative für das bedingungslose Grundeinkommen. Zwei Menschen in einem Geldspeicher sind dort zu sehen. Die Szene erinnert an Dagobert Ducks heilige Hallen, sicherlich nicht ganz ohne Absicht. Ein junges Mädchen stellt klar: „hier befinden sich 8 Millionen Münzen – für jeden Schweizer eine.“ In ihrer zunächst scheinbar naiven Art, aber der immer klüger und vernünftig werdenden Argumentation, beginnt die junge Frau im Film von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zu erzählen. Sätze wie „Wir haben doch soviel hier in der Schweiz, warum soll da jemand zu wenig abbekommen?“ sind einleuchtend und bringen uns zu verblüfftem Lachen. Manchmal schlägt das Einfache, das Naheliegende, mit erdrückender Kraft auf uns ein, als hätten wir es nicht irgendwie alle schon immer geahnt. Während des Films sitzen die drei Vertreter des „Haus Bartleby“ aus Berlin unter der Leinwand vor uns und geben soetwas wie das Bild einer Schulklasse ab. Der Bärtige liegt mit dem Kopf auf seinen übereinandergelegten Armen, der Anzugträger tippt emsig auf seinem Smartphone und Alix sitzt aufmerksam lächelnd, mit dem Blick ins Publikum gerichtet. Daniel Häni, in ruhiger, väterlicher Art, erscheint eine Szene weiter im Film und ergänzt seine junge Mitstreiterin: „Bedingungsloses Grundeinkommen ist Geld zum Arbeiten, nicht zum Nichtstun“ und weist darauf hin, dass dieses Nichtstun ohnehin „das Schwiergiste überhaupt“ sei.
Erleichtert und verunsichert lehnen wir alle uns zurück. Ach die Schweizer, sie haben also die Lösung. Aber wir? Was machen wir nun? Warten aufs Grundeinkommen? Und wie verdammt noch einmal erzählen wir unseren Eltern davon, dass wir jetzt unser fertiges Studium doch nicht nutzen wollen, und zwar um richtig durchzustarten, eine Altersvorsorge abzuschließen und vielleicht sogar ein Eigenheim zu finanzieren?
Alix liest wieder vor, diesmal aus der Erzählung des Bartleby, einem jungen Anwalt der seinem Chef Aufgabenstellungen mit dem Satz beantwortete: „Ich würde es vorziehen, dies nicht zu tun“. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie auch das Ende erwähnte, in dem er diesen Satz auch im Gefängnis auf die Frage, ob er etwas zu Essen haben wolle, wiederholte. Jedenfalls fasst sie die kurze Erzählung mit der Einsicht zusammen, dass Bartleby zwar keine Lösung für uns biete, aber immerhin eine schöne Inspiration sei.
Der Mann im Anzug holt währenddessen seine Gitarre hervor und wartet das Ende der Lesung seiner Nachbarhin merkbar ungeduldig ab. „Und jetzt noch etwas für die Hippies!“ sagt er nur noch, bevor er einfache Akkorde anstimmt und Sätze singt wie „Bäume werden auch von selber grün.“ Alix lächelt abwechselt beiden Männern zu und der mit dem Vollbart bereitet den nächsten Filmausschnitt zum Abspielen vor. Pflichtbewusst rollen Teile des Publikums am Fenster die Rollos runter. Für die bessere Sicht, denn draußen scheint ja die Sonne. Im Intro tanzen Ballerinas auf einer Bühne. Schließlich erscheint der Titel. „Arbeit“.
Dann ist alles zuende. Gelächter hier und da. Der Mann im Vollbart weist uns darauf hin, dass sie jetzt fertig sind und kein Material mehr haben. Es sei zwar noch eine halbe Stunde Zeit aber auch „ziemlich heiß hier drinnen“. Jemand ruft noch „lasst uns draußen weitermachen!“. Doch er fährt entschlossen fort: „wir wollten hier eigentlich die Revolution ausrufen, aber das ist nicht drin. Vielleicht brauchen wir das auch garnicht. Lasst uns doch die Welt retten, indem wir einfach nichts tun.“
PS. Es gibt mehrere Verfilmungen der Bartleby Geschichte. Kann man sich angucken, easy, vielleicht nicht ganz legal, aber hey! let me google that for you