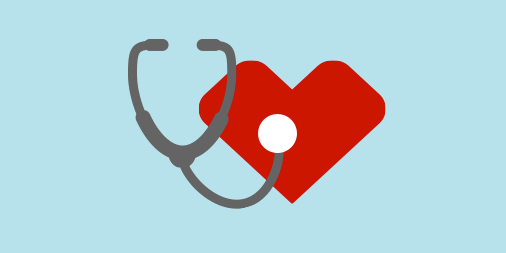Gesundheit ist ein Menschenrecht, doch nicht alle können es in Anspruch nehmen. Für viele Menschen ist der Zugang erschwert, wenn etwa die Sprachkenntnisse fehlen oder das Wissen. Das Gesundheitskollektiv in Berlin will zeigen, dass es auch anders geht.
Irgendwann sind die Schmerzen nicht mehr auszuhalten, der junge Mann geht ins Krankenhaus. Er hat einen Harnleiterstein. Der ist vor allem schmerzhaft, macht auf Dauer aber auch die Niere kaputt. Marian, der eigentlich anders heißt, bekommt Schmerzmittel und wird wieder nach Hause geschickt. Zu Hause, das heißt: die Couch von einem Bekannten. Denn: Er hat keine eigene Wohnung, hat keine Krankenversicherung – keinen Aufenthaltsstatus. Marian kommt aus Südosteuropa und lebt ohne Papiere in Deutschland.

Er leidet weiter, die Schmerzen werden unerträglich. Untersuchungen zeigen, dass der Stein entfernt werden müsste – eine teure Operation. Das Krankenhaus meldet sich beim Medibüro in Berlin, das für Menschen ohne Versicherung immer wieder Behandlungen bezahlt. Doch die Kosten sind zu hoch, das Medibüro überlastet. Marians letzte Chance: eine Abrechnung über das Asylbewerberleistungsgesetz.
Dafür muss sich Marian zuerst an die Sozialberatung wenden. Das heißt gleichzeitig: die Abschiebung droht. Denn Sozialämter sind dazu verpflichtet, Informationen an die Ausländerbehörde weiterzugeben. Ein Dilemma. Marian entscheidet sich für die Gesundheit und lässt sich behandeln. Kurze Zeit später muss er gehen. Er verlässt erst seine Couch und dann Deutschland.
Lukas Kratzsch kann viele solcher Geschichten von seiner Arbeit beim Medibüro in Berlin erzählen. Manchmal mit Pointe, oft dramatisch – nur witzig sind sie selten. Seit 1996 vermittelt die Stelle ehrenamtlich Menschen ohne Aufenthaltsstatus und Krankenversicherung an behandelnde Ärzte und Krankenhäuser weiter. Über die Kosten für eine anstehende Operation wird in der Gruppe abgestimmt. »Wir versuchen, möglichst keine Gatekeeper zu sein. Unterstellen niemandem einen Missbrauch«, sagt Kratzsch. Doch wegen der hohen Nachfrage lässt sich das ungewollte Gatekeeping, also die Kontrolle über die Verfügung von Ressourcen durch jene, die entscheiden, wer teilhaben darf, einfach nicht vermeiden.
Ein ungehinderter Zugang zur Gesundheitsversorgung ist offiziell ein Menschenrecht. Trotzdem gilt es nicht für alle. Viele Menschen werden vom System ausgeschlossen, wenn nicht geklärt ist, wer später die Kosten übernimmt. Noch immer gibt es in Deutschland Menschen ohne Krankenversicherung. Laut der Organisation »Ärzte der Welt« sind es Hunderttausende, genaue Zahlen lassen sich nicht erheben. Und das obwohl in Deutschland seit 2009 die allgemeine Versicherungspflicht gilt. Wie kommt es dazu, dass Menschen durchs Raster fallen?
Erst, wenn die Luftröhre zugedrückt wird
Die Unversicherten bestehen aus verschiedene Gruppen: Zum einen sind es Menschen wie Marian ohne Aufenthaltsstatus, die also ohne Papiere in Deutschland leben. Außerdem gibt es EU-Bürger, die in ihrem Heimatland nicht ausreichend versichert sind und Wohnungslose. Daneben gibt es die Gruppe der selbständigen Deutschen: Wer die Beiträge für die Krankenkasse nicht mehr zahlen kann, kann nicht so leicht wieder ins Regelsystem zurückkehren. Die nicht gezahlten Beiträge müssen in Form von Beitragsschulden zurückgezahlt werden. Oft entstehen so hohe Kosten, die nicht alle stemmen können. Zudem gibt es Au-Pairs oder internationale Studierende, die unterversichert sind.
»Bei Menschen ohne Aufenthaltsstatus ist der Ausschluss besonders dramatisch«, erklärt Kratzsch vom Medibüro. Diese werden dem Asylbewerberleistungsgesetz zugeordnet und haben damit Anspruch auf eine grundlegende Versorgung. »Vor allem Krankheiten, die über einen längeren Zeitraum Schaden anrichten, werden nicht ernst genommen«, kritisiert Kratzsch. Damit sich die Menschen überhaupt behandeln lassen können, benötigen sie einen Krankenschein von der zuständigen Sozialbehörde. Und wie sich beispielsweise bei Marian zeigt, steckt hier der eigentliche joke, wie Kratzsch es nennt. Das Sozialamt ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Ausländerbehörde über die Papierlosen zu informieren. Folglich vermeiden es die Menschen, zum Arzt zu gehen.
Die Angst vor dem Arztbesuch führt dazu, dass Erkrankungen lange verschleppt werden. »Manche mit Krebserkrankungen kommen erst, wenn zum Beispiel die Luftröhre vom Krebs bereits zugedrückt wird«, erklärt Kratzsch, »dann sitzt du da und denkst dir: ja, scheiße – wärst du mal vor zehn Jahren gekommen.«
Angst vor einer Abschiebung ist dabei nur ein Grund. »Kosten der Behandlung, Unsicherheit darüber, wo die notwendige Behandlung zu finden ist und Sprachbarrieren sind weitere Gründe, warum Hilfe nicht oder häufig zu spät in Anspruch genommen wird«, heißt es in dem Bericht »Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Papiere« vom April 2017 der Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität. Ein ungehinderter Zugang zur Gesundheitsversorgung existiert also nicht. Momentan werden die Menschen meist in Parallelstrukturen zum Gesundheitssystem versorgt. Verbände und Vereine wie etwa »Malteser Medizin«, »Ärzte der Welt« oder die Medibüros bieten Sprechstunden, meist auf ehrenamtlicher Basis, an. Sie sind verbunden mit Praxen und Ärzten, die bereit dazu sind, PatientInnen unentgeltlich zu behandeln und vermitteln die Menschen so weiter. Auch Gesundheitsämter leisten eine gewisse Grundversorgung. Wie groß die Unterstützung dort ausfällt, unterscheidet sich je nach Bundesland und Stadt.
Es existieren bereits einige Ideen, um die Ehrenämter zu entlasten. Zum Beispiel gibt es in vielen größeren Städten bereits das duale Modell der Clearing-Stelle: Menschen ohne Versicherung können sich dort hinwenden und Sozialarbeiter versuchen einen Weg für sie zurück ins Regelsystem zu finden. Auch hier wird die Geheimhaltung der persönlichen Daten gewährleistet.
Ein anderes Modell, das beispielsweise schon in Hannover und Göttingen seit 2016 umgesetzt wird, ist der anonyme Krankenschein. Die Idee ist dabei folgende: Menschen ohne Papiere können diesen bei Sozialämtern abholen, ohne dass Daten an Behörden weitergegeben werden müssten. Mit dem Schein haben sie einen ungehinderten Zugang zur Versorgung. Auch in Berlin soll er demnächst eingeführt werden, erklärt Lena Högemann, Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Berlin.
Wer ärmer ist, stirbt früher
Von Berlin nach Frankfurt: Beim Occupy Camp demonstrieren Menschen gegen soziale Ungleichheit und die Übermacht der Finanzmärkte. Ein südländisch aussehender Mann wird getreten, er ist verletzt. Eine Frau bekommt es mit und begleitet ihn in die Rettungsstelle. Doch die Rettungskräfte wollen ihn nicht behandeln. Der Grund: Er hat keine Versicherungskarte. Die junge Frau ist wütend.
Auch heute noch, sieben Jahre nach dem Vorfall, wenn sie die Geschichte erzählt. Ihr Name ist Kirsten Schubert, sie ist selbst Ärztin. »Die ärztliche Ethik sollte sein: erst behandeln, dann über die Finanzierung nachdenken«, sagt sie. Doch in Deutschland sind Gesundheitsprojekte erstmal ans Finanzielle gekoppelt.
Jetzt will sie ein Zeichen dagegen setzen. Zusammen mit 25 MitstreiterInnen hat sie ein gemeinnütziges Gesundheitszentrum in Berlin-Neukölln aufgebaut – das Gesundheitskollektiv Berlin. Ihr Ziel lautet: »Gesundheit für alle«. Ärzte, Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Wissenschaftler sind mit im Team, denn Gesundheit soll mehr sein als nur medizinische Versorgung. Dass dies sinnvoll ist, zeigen verschiedene Studien.
Wer ärmer ist, der stirbt früher, geht aus einer Studie des Robert Koch-Instituts aus dem Jahr 2015 hervor. In Deutschland leben SpitzenverdienerInnen bis zu zehn Jahre länger als Menschen aus der untersten Einkommensgruppe. Auch der Bericht »Closing the gap in a generation« der WHO aus dem Jahr 2008 bestätigt: Noch immer hängt die Gesundheit am meisten von sozialen Faktoren ab. Also zum Beispiel davon, wie Menschen wohnen, wie viel sie verdienen.
»Schon bei Kindern zeigt sich, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen sozialem Status und Gesundheit – und der breitet sich im Laufe des Lebens immer weiter aus«, erklärt Jan Paul Heisig. Der Soziologe beschäftigt sich mit dem Einfluss von sozialen Faktoren auf die Gesundheit. Viele Krankheiten brechen zwar erst im höheren Alter aus, doch der Grundstein werde häufig schon in der Kindheit gelegt. Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist von Fall zu Fall verschieden.
Gegen Rassismus hilft auch kein Sport
Soziale Unterschiede zu verringern ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem und kann nicht nur vom Gesundheitssystem beeinflusst werden. Für das Gesundheitskollektiv war der Bericht der WHO damals ausschlaggebend. Daher will das Kollektiv mit den Menschen direkt in Kontakt treten. Bei mobilen Gesundheitsberatungen werden Menschen über verschiedene Themen aufgeklärt. »Unser Gesundheitssystem ist zersplittert, oft wissen die Menschen gar nicht, welche Leistungen ihnen zustehen«, erklärt Schubert.
Auch Stadtteilbefragungen sind ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Dabei will das Team herausfinden, welche Bedürfnisse und Wünsche es in dem Stadtteil konkret gibt. Heisig bestätigt: »In der Prävention gibt es noch einen großen Spielraum, gerade im Hinblick auf psychische Erkrankungen sind präventive Ansätze enorm wichtig.«
Ob Medibüros oder Gesundheitskollektiv: Führen solche Parallelsysteme nicht dazu, dass sich der Staat stärker aus der Verantwortung zurückziehen kann? »Es wird sich definitiv zu viel darauf verlassen, das ist aber auch ganz normal«, erklärt Kratzsch. Schubert stimmt zu: »In einem kapitalistisch strukturierten Land kann die Gesundheitsversorgung nicht alleinige Aufgabe des Staates sein.« Solange Ärzte selbst und andere Organisationen Profite generieren können, wird es auch Fehlfunktionen geben.
Schubert wünscht sich vor allem einen Wandel vom derzeitigen Gesundheitssystem. Es sollte vermehrt Gesundheitszentren geben, vor allem in Problemkiezen in Großstädten, aber auch in ländlichen Regionen. Es sei natürlich wichtig, dass die zahlreichen Barrieren abgebaut werden. Aber eben auch, dass der Ansatz über die rein medizinische Versorgung hinausgeht.
»Eine Gesellschaft, in der es massiv gute Gesundheitssysteme gibt, aber die Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht ausreichend sind, wird das System nichts retten können«, sagt Schubert. Denn manche Lebensumstände machen nachweislich krank. »Gegen hohe Mieten, Arbeitslosigkeit oder auch Rassismus hilft eben auch kein Sport.«
Schubert sagt: »Wir wollen keine Lückenbüßer sein, wir versuchen alternative Leuchttürme aufzubauen, um zu zeigen, dass es anders gehen könnte.« Auch für das Medibüro ist die Arbeit »keine Ehre«, wie es 2015 in einem Bericht schreibt. »Wir sind ein rebellisches Ehrenamt«, bestätigt Kratzsch. Das heißt: Das Medibüro macht die Arbeit nicht, weil sie wollen, sondern weil es keine Alternative gibt. Dabei ist die Beratung der Menschen im Büro nur eine Säule. »Die wichtigere Säule ist, dass wir uns politisch engagieren vor Ort«, sagt der Aktivist. Denn das eigentliche Ziel der Medibüros ist die Selbstauflösung: Endlich nicht mehr gebraucht werden.
Illustration: Anna Knopf für transform Magazin