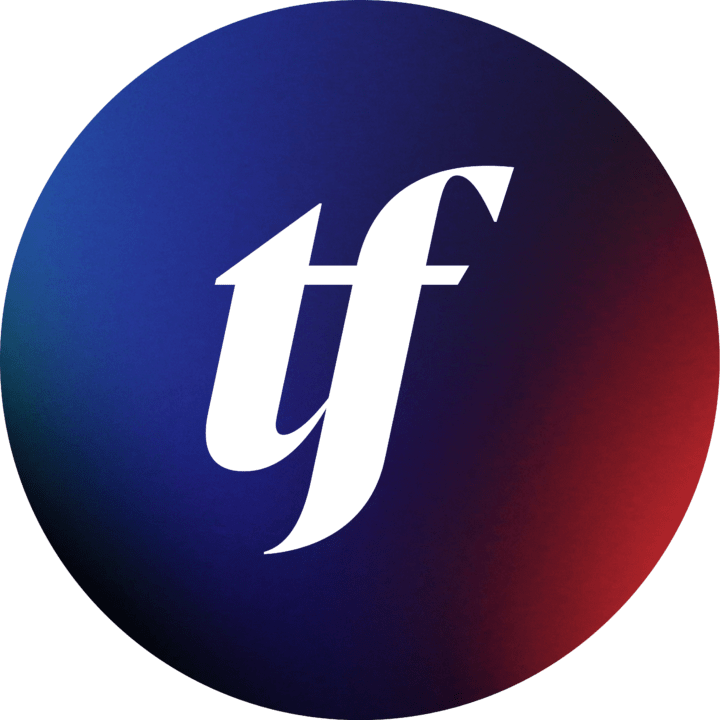Dem Tinder meine verführerische Seite, dem Instagram meine so dermaßen genussreiche und weltmännische Feinschmeckerseite, bei Snapchat meine so ulkige Spontanität, auf Facebook natürlich mein weites Netzwerk und die total unverkrampften Gruppenselfies und wie zielstrebig und koordiniert bin ich doch bei Linkedin! Viele Tabs sind in unseren Köpfen geöffnet.
Wir jonglieren mit Rollen als wären es Plastikbälle. Und aus genau diesem bunten Plastik scheinen auch die Identitäten zu sein, die wir uns da basteln. Und was ist dahinter, möchte man fragen. Wie viele Ichs passen denn in einen Menschen? Wie viele Rollen kann man spielen ohne sich selbst zu verlieren?
Es stimmt, dass die Digitalisierung, also hier die Verlagerung von Prozessen und eben auch Interaktion in virtuelle Netzwerke, die Rollen, die wir spielen, verflüssigt. Doch statt Horrorszenarien aufzubauen schafft diese Verflüssigung neue Freiräume. Die Digitalisierung kann unser Selbstverständnis facettenreicher, spannender und freier machen – wir müssen nur wissen wie!
„Aber ach! Ein Schauspiel nur!“ – Maskenspieler waren wir schon immer
Es ist ein wohlbekanntes Gefühl in der digitalisierten Interaktion, dass man sich wie ein Schauspieler fühlt. Überrascht ist man über sein schauspielerisches Talent. Und was ist ein Schauspieler, der den Drehschluss nicht bemerkt?
Das Problem des Schauspielers ist so natürlich nicht neu: “All the world’s a stage/And all the men and women merely players/They have their exits and their entrances/And one man in his time plays many parts.” So schrieb Shakespeare, der nicht einmal Facebook hatte!
Natürlich ist menschliche Interaktion immer schon Rollenspiel gewesen: Man spricht mit seinem Partner anders als mit dem Verkäufer in der Bäckerei. Für alle Beteiligten wahrscheinlich eine gute Idee. Das „Rollenspiel“ funktioniert nach dem Soziologen Erving Goffman wie folgt: Wir präsentieren unserem Gegenüber eine Art Maskensammlung, probieren bestimmte Masken aus, passen die Masken an das Feedback des Publikums an und sind konstant darum besorgt, die beste “stage performance” abzuliefern. Genau die richtige Maske im richtigen Moment tragen, das ist Kommunikation!
…doch Digitalisierung potenziert dies
Wie immer macht die Dosis das Gift, in der Digitalisierung herrscht Schauspielerei extrem: Beim analogen Gang zum Bäcker habe ich immerhin genug Zeit, um meine Maske aufzusetzen, meine Rolle ist durch einen Ort und einem Moment zeitlich und lokal klar definiert. Der Bäcker spielt dann altbekannte Gassenhauer wie “Ihnen auch ein schönes Wochenende!” oder “Bei dem Wetter? Mal schauen hahaha”.
Ganz anders die digitalisierte Interaktion: Sie findet an allen Orten und Zeitpunkten gleichermaßen statt: Kurz noch ein Meme in die Whatsapp-Gruppe gepostet, die Mutter ruft an, Follow-Up Nachricht an die Leiterin des interessanten Workshops. 24 Gespräche auf 6 Kanälen.
Das Resultat sind stabilisierte Rollen: Situationen erzeugen Masken, aber Masken erzeugen auch Situationen. Die Rollen, die ich spiele, existieren und agieren ständig und parallel. Diese Rollen treten dann in Wechselwirkungen zu einander und es entsteht ein digitales Eigenleben. Das führt auch dazu, dass der Übergang zwischen der „Rolle“, die ich spiele, und der Identität, die ich in mir trage, ein fließender wird. Die Masken jonglieren dann mehr mit mir als ich es tue. Das Beim-Bäcker-Ich existiert Sonntagmorgens. Die digitalen Ichs sind in Form von Avataren immer ansprechbar und sichtbar.
Wie eine Identitäten damit eine Eigendynamik gewinnen, erlebte ich, als ich einem guten Freund vom Urlaub berichten wollte und er ablehnte, er habe das ja eh‘ schon alles bei Facebook miterlebt. Du? Dort? Man ist irritiert, weil es zu einer Kollision der Masken gekommen ist. Als ginge man auf die Bühne und spielte das falsche Stück. Im englischsprachigen Raum hat man dafür einen wunderbaren Begriff, der sich einfach nicht richtig übersetzen lässt: awkward. So awkward, wie wenn die zukünftige Kollegin dich schon über deinen Instagram-Account kennt.
Was herauskommt ist eine tendenzielle Aufsplittung des Ichs. Denn beide Darstellungen sind echt: Die Urlaubsbilder auf Facebook und der gescheiterte Urlaubsbericht im Wohnzimmer. Beide Rollen, die wir spielen, sind authentische Teile von uns. Ich sind viele könnte man sagen, doch leicht über die Lippen geht das nicht. Warum eigentlich?

Das stabile „Ich“ ist eine Idee der Literatur
Als Kinder unserer hyper-individualiserten Zeit, scheint es uns unvorstellbar, an ein „ich“ zu denken, welches nicht klar umrissen und abgegrenzt von der Umwelt und den „Anderen“ ist. “Ich bin das, was ich bin” – ist der Slogan unserer Tage. Die Wurzeln dafür liegen in der Literatur: Das Bild eines konsistenten Selbst entstand durch die Romane des späten 18. Jahrhunderts, so der Literaturwissenschaftler Klaus Theweleit: „einsetzend mit den Personenentwürfen Samuel Richardsons und Jean-Jacques Rousseaus von etwa 1740 an, also mit Entwicklungen innerhalb der werdenden bürgerlichen Gesellschaft, die später unter dem Begriff Aufklärung gefasst werden.”. Vorher, so Theweleit, gab es “dieses Ich” gar nicht.
Später wurde daraus das höchstpopuläre Genre der “Bildungsromane”. Hier lasen Millionen, wie der verwirrte Protagonist letztendlich sein “Ich” findet, sein „Ich“ herausbildet, so ein richtig stabiles „Ich“. Die Fans der Bildungsromane Hermann Hesses wurden „Hippies“ genannt“ und begaben sich dann auf Selbstfindungsreisen, ihr eigenes „Ich“ zu bilden. Komisch, dass so wenige mit einem stabilen “Ich” zurückkamen. Alle wollen sich selbst finden, aber wer hat sich je gefunden? Vielleicht sind wir dieser literarischen Idee des einen festen Ichs einfach zu sehr aufgesessen? Eben weil das „Ich“ durch und durch eine Erfindung, eine soziale Konstruktion, ist, vorgetragen und verfestigt durch literarische Bestseller.
Dies bringt uns zurück zur digitalen Kommunikation. Schreiben als Ich-Findung: die Digitalisierung ist nicht zuletzt eine Revolution des Schreibens, wie Andrea Lunsford von der Stanford Universität es nennt. Noch vor wenigen Jahren haben die meisten Jugendlichen fast ausschließlich nur geschrieben, um Schulpflichten zu erfüllen. Und in den meisten Berufen hat man selten einen Text verfassen müssen. Dank Internet sei privates Schreiben aber wieder zu einer alltäglichen Praxis geworden, die Unmengen an Text produziert.
“Wenn richtig ist, dass Schreiben der Selbsterkenntnis dient, dann erleben wir eine Steigerung der Sensibilitäten gegenüber uns selbst”, schreibt Christoph Kucklick dazu. Wir lassen uns nicht mehr Bücher verkaufen, in der ein idealisierter Held sein “Ich” findet, wir beginnen selbst zu schreiben, ständig und an ständig wechselndes Publikum. Und kommen damit unserem fließenden Ich viel näher.
Dadurch, dass die Digitalisierung die Konstruktion der Identität als eine literarische Idee entlarvt und uns so zu freischaffenderen Ich-Virtuosen machen kann, kann sie uns einen großen Dienst erweisen.
Die Ich-Virtuosen: Mehr Ichs sind besser als ein Ich
Indem die Digitalisierung eine Mehrstimmigkeit von Ichs befeuert macht sie uns sichtbar, dass unsere Identität widersprüchlich ist, und wir alle von Normen abweichen – auch von unseren eigenen. Diese Mehrstimmigkeit ist uns nur unangenehm, solange wir noch an die „Ich-Finder“ von Thomas Mann und Hermann Hesse denken.
Aber die Mehrstimmigkeit ist hilfreich! Wir gehen toleranter mit uns selbst und mit Anderen um. Mehr Ichs bedeutet einmal, offen zu sich zu sein. Sich einzugestehen, dass man sich verändert. Oder sogar, dass alles was „ich“ ist, ständig fließt. Damit müssen wir uns nicht einengen lassen in Bildern, die vorgeben, dass jemand „wie ich“ so oder so zu handeln hat. Das heißt nicht, dass man keine Überzeugungen mehr hat, das heißt, dass man sich der Überzeugungen bewusst wird, die wirklich „meine eigenen“ sind. Das führt dazu, dass der Banker abends einen Blog über Marx schreiben kann. Oder das Projekte, wie das großartige aber auch großartig schrullige MC1R-Magazin für Rothaarige durch das Internet eine weltweite Leserschaft bekommen können. Wir trauen uns und anderen zu, viel feinteiligere Interessen jenseits des Mainstreams zu verfolgen.
Die Mehrstimmigkeit des Ich liefert so den Weg in eine individuelle Existenz, die ja auch immer eine fließende Existenz ist. Wenn wir das für uns verstehen, dann können wir auch die anderen in diesem Fluss verstehen. Wir können dann verstehen, warum Menschen selten unserem Bild von ihnen gerecht werden und auch nicht ihrem eigenen.
Für den Philosophen Emmanuel Levinas beginnt Ethik damit sein Gegenüber zu akzeptieren als jemanden der nicht zerlegbar ist in eigene Begriffe und Vorstellungen. Eine Mehrstimmigkeit geht in diese Richtung wenn man akzeptiert, dass das Verständnis, der Name, ja auch das Geschlecht meines Gegenübers nicht in Granit gemeißelt ist. Da ist zum Beispiel der amerikanische Arzt, der kurz vorm Burnout stand, und dann sein Rap-Alter-Ego ZDoggMD erfand, mit der seine Erfahrungen mit dem Gesundheitssystems in Rapsongs verpackt. Das gehört sich nicht für ein Arzt? Millionen Zuschauer sehen das anders.
Digitalisierte Ichs bedeuten, dass wir uns davon verabschieden müssen, den Anderen auf ein schlichtes Bild herunterzubrechen. Es wäre das Ende dieser dämlichen Frage auf Parties „Und wer bist du so?“. Wir würden diesen Menschen wirklich zuhören, statt zwischen den Zeilen zu fragen: „In welche Schublade darf ich dich denn zwängen?“
Das Ich als ein Gemeinschaftsprodukt
Ein durch die Digitalisierung mehrstimmig gewordenes Ich zeigt auch, dass “Ich” und die “Anderen” nicht so richtig zu trennen sind. Denn was ist “Ich” ohne die anderen? Gebunden bin ich durch Orte, Ereignisse, Sprache, Freuden, Leiden, Vorfahren, Freunde und Erinnerungen, analysieren die französischen Philosophen des Comité Invisible. Alles Dinge, die ich nicht “ich” nennen kann. Eigentlich ist alles, was mich an diese Welt bindet, sind alle Kräfte in mir nicht unter den einen Hut des festen „Ichs” zu bringen. „Ich“ bedeutet vielmehr gemeinsame Existenz, ein Teilsystem, das sich auf Kommunikation mit anderen Teilsystemen einlassen muss und sich dabei ständig verändert.
Die Mehrstimmigkeit bettet den Einzelnen also auch wieder in die Gemeinschaft ein, macht Ichs zu einem gemeinsamen Produkt. Reißt die Grenzen nieder die ein Konkurrenzkampf “authentischer Ichs” zwischen uns aufzieht.

Das Ich als Befreiung
Mehrstimmigkeit von Ichs besitzt einen Hauch von Emanzipation. Denn bei einem Stabilen „Ich“ ist der einseitige Einfluss der Gesellschaft sehr groß. Das fängt beim Namen an, gewissermaßen der fixen Überschrift für dieses Ich. Der Name hat großen Einfluss auf das Selbst und ist immer von außen vorgegeben. Es macht einen Unterschied, ob ich Kevin, Mustafa oder Richard, Hatice oder Shira heiße. Davon hängen Selbst- und Fremdbild ab. Diese Starrheit und Sturheit aufzubrechen und Mehrstimmigkeit in der Identität zu begreifen, wäre ein Akt der Befreiung vom statischen „Ich“.
Tausendfach drücken sich Menschen online so aus, wie sie es offline aufgrund bestimmter Labels nicht könnten. Und bringen z.B. als Aktivisten Menschenrechte voran.
Die Mehrstimmigkeit kann also Voraussetzung dafür sein, dass wir zu einer toleranten Gesellschaft finden, in der wir offen und ohne Versteckspiel in der Privatsphäre ganz wir selbst sein können. Eine Gesellschaft in der niemand mehr im Korsett einer kollektiven Rollebestimmung gefangen sein muss, um der Einzelne somit mehr Freiheit erreicht.
Digitales Testgelände – Digital aufgeklärt
Und das Testgelände dafür entdecken wir im Digitalen, wo wir uns bereits andere Namen geben und auch viel mehr mit unserer Identität experimentieren sollten.
Das geht natürlich nicht indem wir immer mehr Entscheidungen an Apps delegieren, immer mehr Informationen preisgeben und durch diese Bequemlichkeit schon entmündigt werden. Es geht darum, dass wir vom User und von der Datenkuh mehr zum experimentierfreudigen Virtuosen werden, der die fluide Mehrstimmigkeit im Netz für sich zu nutzen weiß. Es geht dann darum, dass Spiel als ein Spiel zu erkennen. Sich zu erfinden, und wissen, dass es eine Erfindung ist. Oder sich eigene Identitäten zu basteln, die besser passen als die, die ihnen aufgebürdet werden. Und damit das Projekt der Aufklärung, der Ausgang des Menschen aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit, für sich und sein digitales Selbst zu nutzen wissen. I like.
Beitragsbild: CCO Tom Sodoge (unsplash)
Artikelbilder: CCO Tim Gouw (unsplash), CCO David Cohen (unsplash)