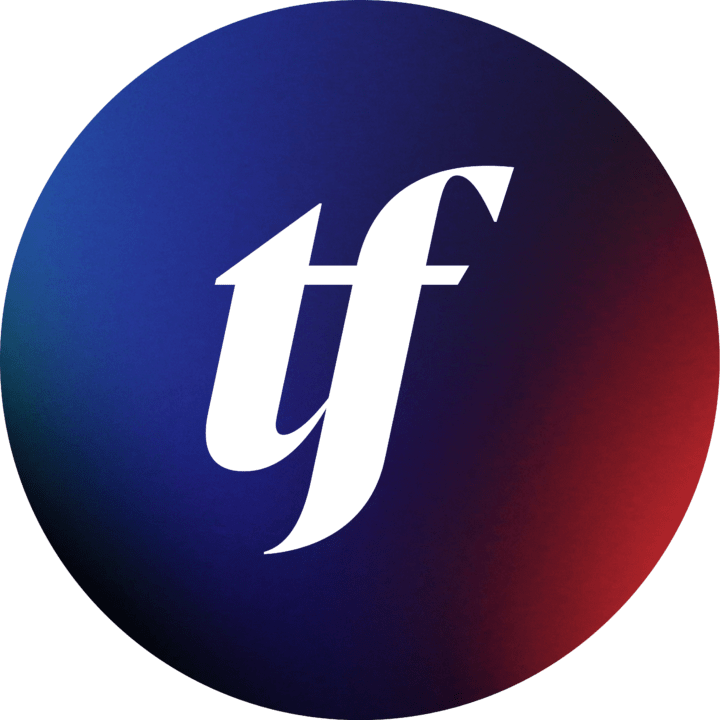Bisher überlassen wir die Zukunft der Mobilität viel zu oft Start-ups aus dem Silicon Valley, die sich mit Milliardeninvestitionen aufgepumpt haben. Dabei würde es sich viel besser anfühlen, manche Mobilitätsangebote in die Hände von Genossenschaften zu geben, findet unser Gastautor Sebastian Hofer.
Letztens, als ich in Hamburg mit meinem Fahrrad an der Elbe entlang in Richtung Fischmarkt fuhr, kam ich an einem weißen Transporter vorbei, dessen Heckklappen geöffnet waren. So konnte ich sehen, dass hier gerade die Verteilung von E-Scootern-im Gange war. Ihre Rückleuchten waren alle aktiviert, was bei den vielen wild übereinander gestapelten E-Scootern meine Aufmerksamkeit anzog. Der junge Mitarbeiter hatte seine Cap ziemlich tief ins Gesicht gezogen, weshalb ich mich fragte, ob er lieber nicht erkannt werden wollte. Er sah müde aus und wirkte, als beeilte er sich, die vier abgestellten E-Scooter bereit für die Entleihe zu machen.
Auf einmal hatte ich ein Gesicht zu der Person, die womöglich auch schon mal einen E-Scooter für mich abgestellt hatte. Das rief bei mir ein gemischtes Gefühl hervor. Einerseits Dankbarkeit dafür, dass es Menschen gibt, die mir diese Art von Mobilität ermöglichen. Andererseits Verwunderung darüber, dass man von diesen Mitarbeitenden so wenig hört und sieht. Und außerdem Scham, weil ich in meinem Konsumverhalten bestimmt noch nie Wertschätzung gefühlt oder gar ausgedrückt habe für ihren Anteil an meinen so komfortablen E-Scooter-Erlebnissen.
Auf dem Rücken der Gig Worker
Als der E-Scooter-Sharing-Hype Mitte 2019 auch in Deutschland surrender Alltag wurde, war einer der Hauptkritikpunkte, dass das Geschäftsmodell auf dem Rücken prekärer Arbeitskräfte aufgebaut sei. Allerlei moderne Tagelöhner, tech-bubble-euphemistisch auch Gig-Worker genannt, sorgen in den USA tagtäglich für 5 Dollar pro Scooter dafür, dass diese eingesammelt, geladen und wieder in den Städten verteilt werden. Ein Modell, welches zu besorgniserregenden Effekten wie Bandenbildung der sogenannten Juicer oder Charger – also er Menschen, die die Roller wieder aufladen – oder Betrug durch versteckte Scooter führte, klingt für mich allerdings weder fair noch funktionstüchtig.
In Deutschland und Europa verwarfen übrigens die meisten Anbieter dieses Konzept sehr schnell und nahmen stattdessen in der Regel Subdienstleister unter Vertrag, welche diese unliebsame Arbeit immerhin zum Mindestlohn verrichten lassen müssen. Der amerikanische Anbieter Lime war hier jedoch eine Ausnahme und deshalb wollte ich in Folge 25 meines Podcasts freifahrt von dem Lime-Deutschlandchef Jashar Seyfi wissen, warum dieser elementare Bestandteil der Dienstleistung nicht stolz von Mitarbeitenden der eigenen Firma geleistet wird. Aus seiner Sicht sei ein Großteil der Kritik unberechtigt gewesen und dennoch haben sie das Juicer-Modell aufgrund des massiven Gegenwinds in Deutschland im Dezember 2019 gestoppt. Unfreiwillig, denn eigentlich ist er überzeugt, dass gerade diese nicht über einen Arbeitsvertrag geregelte Tätigkeit den Vorteil mit sich gebracht hätte, sozial benachteiligten und schlecht Deutsch sprechenden Menschen ein Einkommen zu ermöglichen. „Eine meiner frustrierendsten Entscheidungen war, das Juicer-Modell zu beenden und diesen Menschen ihre Einkommensquelle wieder wegzunehmen“
Es ist schlimm genug, dass mit dem Argument des Start-up-Welpenschutzes, des schnellen Marktzugangs, der maximalen Flexibilität, mit Humanressourcen umgehen zu müssen oder kurzfristig auf Gelerntes reagieren zu können, prekäre Arbeitsverhältnisse gerechtfertigt werden. Wenn die Anbieter von E-Scootern – und ich sehe sie hier stellvertretend für weitere Sharing-Unternehmen – zu einem respektablen Teil des urbanen Mobilitätsangebotes werden wollen, wird es Zeit, dass sie auch solide Arbeitsplätze schaffen.
Denn die Frage, welche daraus für mich resultiert, ist: Wie fühlt es sich für euch an, einen Dienst zu nutzen, welcher auf dem Rücken von Menschen aufgebaut ist, die trotz dieser anstrengenden Arbeit um eine würdevolle Finanzierung ihres Lebensunterhaltes kämpfen müssen.
Am selben Tag habe ich mir dann übrigens noch eine Fahrt beim Ridesharing-Anbieter MOIA gebucht und habe mir vorgenommen, nicht so wortkarg einzusteigen und weiter meinen Podcast zu hören oder auf meinem Smartphone herumzuwischen wie sonst. Ich wollte ins Gespräch kommen mit der Fahrerin, wenn sich im Vergleich zu einem Linienbus oder einer U-Bahn schon die greifbare Gelegenheit ergibt. Denn mir ist aufgefallen, dass ich das bei der einen oder anderen meiner eher seltenen Taxifahrten immer gerne gemacht habe. Bei Angeboten wie CleverShuttle, Berlkönig oder MOIA hingegen steige ich ein und nehme die Fahrer:in als Teil des Services war, an mein Ziel gefahren zu werden. Die Verbindung zwischen uns, welche durch das kurze Gespräch über ihre Arbeitsrealität und ihre berufliche Vergangenheit entstanden ist, hat mein und hoffentlich auch ihr Erlebnis der Fahrt deutlich verbessert und ist vermutlich der Grund, weshalb ich mich genau an diese Fahrt heute noch erinnere. Im Nachhinein hätte ich sie damals gerne explizit danach gefragt, was es mit ihr macht, wenn sie mal nicht wie eine digitale Dienstleistung behandelt wird.
Denn das Problem ist, dass die digitalen Dienste unseres Alltags uns ein Gefühl der Distanz geben. Unser Konsumhunger wird in dieser neuen Einfachheit nur so befeuert und wir vergessen dabei uns und unser soziales Umfeld. Paradoxerweise liegt der Erfolg von Social Media Diensten dann wiederum gerade in der Erfüllung unseres Wunsches nach Verbindung und Austausch, wie auch die sehr empfehlenswerte Netflixdoku „The Social Dilemma“ eindrücklich auf den Punkt bringt.
“Before social media there was society and media.
Nobody knew what either was good for”
(Eric Jarosinski)
Du wirst mir immer fremder.
Die Sozialforschung bezeichnet dieses Phänomen mit dem Begriff der Entfremdung, einem Begriff, welcher bereits Gegenstand der Gesellschaftskritik von Rousseau und Marx war. Zur Untersuchung insbesondere des Zusammenhangs zwischen der sozialen sowie technischen Beschleunigung und der Entfremdung stellte der Soziologieprofessor Hartmut Rosa im Jahr 2013 in seinem Werk „Entfremdung und Beschleunigung“ heraus, wie problematisch eine aufgrund der sozialen Beschleunigungsprozesse verzerrte Beziehung zwischen dem Selbst und der Welt ist. Was vielleicht wie ein typisches sozialphilosophisches Elfenbeinturm-Thema klingen mag, stellt tatsächlich die sehr konkrete Frage nach einem gelingenden Leben in den Mittelpunkt.
„Unablässig versucht der moderne Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen; sie ökonomisch verfügbar und technisch beherrschbar, wissenschaftlich erkennbar und politisch steuerbar und zugleich subjektiv erfahrbar zu machen. Daher droht sie uns aber stumm und fremd zu werden. Lebendigkeit entsteht aus der Akzeptanz des Unverfügbaren“, schreibt Rosa. Die Verfügbarmachung als eine Maxime der Wachstumsgesellschaft führe insofern zu dem Gefühl der Entfremdung, „da sich die verfügbar gemachte Welt uns auf geheimnisvolle Weise zu entziehen und zu versperren erscheint.“
Aber zurück zur Mobilität. Auf der Ebene der Mobilitätsunternehmen wird die Entfremdung aufgrund der beschleunigten und komplexen Entscheidungsmöglichkeiten und -prozesse in Form reduzierter erlebter persönlicher Autonomie sichtbar: Wir überlassen die Deutungshoheit über die Zukunft unserer (urbanen) Fortbewegung fast ausschließlich ausländischen Mobilitätsunternehmen wie beispielsweise Uber, Voi, Waymo, Bolt oder Tesla. Unternehmen, die Investitionen von bis zu 25 Milliarden Dollar intus haben und ihre Geschäftsrisiken dennoch an Einzelpersonen ohne Arbeitsvertrag auslagern. Das ganze Geld bekamen sie dabei primär, weil sie Investor:innen die überzeugendsten Geschichten von ihrer Version einer lebenswerten Zukunft für uns alle erzählt haben. Macht sie das zur optimalen Lösung für unsere Probleme? Ich bin skeptisch.
Denn hier wird ein Grundbedürfnis zum Spielball von mit Risikokapital finanzierten Unternehmen, deren Umsätze schließlich auf wenigen Konten weit jenseits der lokalen Wirtschaft landen und welche hinter den Kulissen maßgeblich von ebendiesen Investor:innen mit meist singulären Interessen gelenkt werden. Ohne die lokale Nutzerschaft in die Serviceentwicklung mit einzubeziehen, wird das vermeintlich validierte Produkt auf unseren Straßen gelaunched, wie man so schön sagt. Die Wertschöpfung und der erhoffte Fahrspaß geschehen also lokal, aber die Kasse klingelt anderswo. Dabei bleibt die zentrale Frage offen, ob solch eine schnellstmögliche Skalierung und Wertsteigerung langfristig überhaupt mit den Interessen von Endkund:innen oder gar von Städten, Kommunen und Gemeinden vereinbar sind.
Ein weiteres Symptom der Entfremdung könnte das Gefühl der Ungerechtigkeit sein, das sich in der enormen Kritik an vielen der neuen Anbieter äußert. Sei es wegen der überall herumliegenden E-Scooter, wegen des ausbeuterischen Geschäftsmodells des Ridesharings oder wegen des kurzfristigen Einstellens des Betriebs in Krisenzeiten. Mancherorts zeigt die Entfremdung ihre fiese Fratze überdeutlich in Form von Protesten und Vandalismus. Brennende Uber-Fahrzeuge, bekritzelte Sharing-Fahrzeuge oder E-Scooter in Spree, Elbe und Seine beweisen, dass weder ein persönlicher Bezug zu den Dienstleistungen noch Verantwortungsgefühl gegenüber den Fahrzeugen oder den Menschen dahinter besteht.
Weil das Angebot an sich aber innovativ, glitzernd, neu, zeitgemäß, digital, spannend und oft auch einfach besser ist, erliegen wir dieser kognitiven Dissonanz, es gut finden zu wollen, obwohl es mit tief verwurzelten individuellen und kollektiven Werten kollidiert. Die neue Social-Media App Clubhouse beweist gerade, dass es sogar möglich ist, das gute alte Radio mittels einer App zu digitalisieren, durch ein paar kleine Kniffe in der User Experience zu demokratisieren und so zum reizvollsten rosa Elefanten der Aufmerksamkeitsökonomie werden zu lassen, der gerade so durchs digitale Dorf trabt.
Ironischerweise ist Mobilität inzwischen gleichzeitig einer der größten und somit potenziell profitabelsten Innovationsbereiche für weltweit agierende Unternehmen und Investmentfirmen und gleichzeitig enorm durch die lokalen Gegebenheiten der Stadt- oder ländlichen Struktur, der überregionalen Vernetzung, der gesellschaftlichen Kultur oder der Einkommenssituation der Bevölkerung definiert. „Entscheidend ist, vor Ort Kenntnisse zu haben“, erklärt Jürgen Biedermann von den Stadtwerken Augsburg in Folge 46 meines Podcasts und meint ein Verständnis der Region, der Politik und der Bürger:innen. „Jede Stadt hat ja ihr eigenes Ökosystem und als Augsburger erkennt man mit den richtigen Daten und einem Geoinformations-System den Bedarf schneller und kann das Produkt auch schneller aussteuern. Der Ablauf, wie Sharing funktioniert, egal ob Carsharing oder Bikesharing, ist dann ja immer wieder gleich.“
Ist demzufolge also der inoffiziell identifizierte Gegner aller New-Mobility-Unternehmen, der gute, alte Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), die optimale Organisationsform? Argumente wie der lokale Bezug, die öffentliche Kontrolle, das Prinzip der Daseinsvorsorge, ein hoher Effizienzgrad und die geringeren pro-Kopf Emissionen sprechen natürlich dafür. Dagegen spricht, dass der ÖPNV an den wenigsten Orten der Welt die Prädikate innovativ, glitzernd, neu, zeitgemäß, digital oder spannend verdient. So gibt es heute in Deutschland zwar einige positiven Beispiele, gleichzeitig aber auch genügend gute Gründe, dass Unzufriedenheit bezüglich des ÖPNV-Angebots herrscht und so Raum ist für mehr oder weniger zielführende und gut gemeinte Mobilitätsexperimente. Entweder versucht der ÖPNV es selbst, mit Mobility-as-a-Service Plattformen, also Apps, welche viele Mobilitätsangebote vereinen, wie hvv switch aus Hamburg, MVG more aus München oder jelbi aus Berlin das hauseigene, schnelle Beiboot in die Stromschnellen der Marktentwicklung abzulassen und ist damit aber kaum konkurrenzfähig. Oder man verweigert den Wandel und lehnt sich auf dem Thron des Vergabemonopols zurück.

zu den Fahrzeugen oder den Menschen dahinter besteht.
Gutes Gefühl und gutes Geld
Es ist verflixt. Städte, Kommunen und der ÖPNV sind nicht immer in der Lage dazu, zu ignorant oder haben zu wenig Ressourcen für die notwendige Beschleunigung der Mobilitätswende. Gehypte Mobilitätsunternehmen hingegen sind unzuverlässig, intransparent und aufgrund der Risikokapital Finanzierung auf den schnellen Exit aus.
Die Lösung in der Mitte könnte in dem guten, alten Organisationsmodell der Genossenschaft liegen. Trotz seiner Werte und Struktur, welche wieder mehr denn je in die heutige Zeit passen, führt diese in der öffentlichen Wahrnehmung eher ein Schattendasein und das obwohl laut dem Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. mit 20 Millionen Mitglieder jede:r Vierte Mitglied in einer der 5.600 Genossenschaften ist, bei denen immerhin 800.000 Mitarbeiter:innen tätig sind. Unter anderem entstanden als Selbsthilfemodell für die Landwirtschaft hat die eingetragene Genossenschaft heute immer noch das Image von Sozialromantiker:innen in Birkenstock-Sandalen und Aussteiger:innen aus dem doch eigentlich so glorreichen Neokapitalismus.
Genossenschaften sind, vereinfacht gesprochen, Zusammenschlüsse von Menschen, die in einer basisdemokratisch organisierten, solidarischen Zusammenarbeit gemeinsam ein Ziel erreichen wollen: etwa saubere Energie, bezahlbaren Wohnraum oder eben komfortable öffentliche Mobilität zu schaffen. Und das übrigens nicht in einem geschützten Raum. Sie agieren in direkter Konkurrenz mit anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen und müssen ebenso Gewinne erwirtschaften. Ein Unterschied besteht darin, dass die Gründungsvoraussetzung einer Genossenschaft ein Zweck ist, welcher über den reinen Wirtschaftsbetrieb, die Steigerung des Unternehmenswerts oder die Zahlung einer Rendite hinausgeht. Gewinn wird zum Mittel zum Zweck degradiert. Und während so manches hyperskaliertes Unternehmen gerade versucht, seine Entfremdungswunden oft eher kosmetisch mit dem Purpose-Zaubertrank zu heilen, ist der Genossenschaftsgrundsatz, auf Basis von ethischen Werten wie Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu handeln, hier nicht optional, sondern schon Teil deren DNA.
An dieser Stelle ähnelt sich die Genossenschaftsidee übrigens sehr stark dem Konzept der Purpose Economy, welche in Deutschland maßgeblich von der Organisation Purpose vorangetrieben wird. Und tatsächlich haben Armin Steuernagel und seine Mitgründer:innen diese selbst als eine eingetragene Genossenschaft gegründet, welche nach eigenen Angaben dem Prinzip des Verantwortungseigentums gehorchend, sich selbst gehört. Genau diese Eigenschaft ist auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen deren Modell einer Purpose-GmbH und einer Genossenschaft. So können laut diesem Weißbuch von Purpose „Genossenschaften zwar auch oft eine gute Struktur für Verantwortungseigentum sein, von ihrer Grundstruktur her machen sie das Unternehmen dennoch zu einer Ware, die bei Zustimmung der Mitglieder gewinnbringend verkauft werden kann. Unternehmen in Verantwortungseigentum können zwar genossenschaftsähnliche Strukturen aufweisen, Stimm- und Gewinnbezugsrechte sind dabei jedoch so voneinander getrennt, dass kein wirtschaftliches Interesse am Verkauf des Unternehmens besteht“
Aus dieser Logik heraus könnte man nun fordern, alle Unternehmen in Verantwortungseigentum zu übertragen. Dieselbe Forderung funktioniert hingegen nicht für Genossenschaften. Denn die basisdemokratische Mitbestimmung als Kernelement der Genossenschaft wird vor allem dann ein sinnvolles Instrument, wenn der regionale Bezug und auch der Unternehmenszweck, ein Grundbedürfnis wie die Mobilität zu bedienen, im Vordergrund stehen. Wer Mitglied einer Genossenschaft wird, erwirbt ähnlich wie ein Aktionär Miteigentum am Unternehmen, wobei jedes Mitglied unabhängig von der Höhe seiner Einlage nur ein Stimmrecht hat. „Human diversity is a resource, not a handicap,“ formuliert die amerikanische Kulturanthropologin Margaret Mead einen wohlklingenden Leitsatz und unterstreicht damit den Wert verschiedener Perspektiven und Wertevorstellungen. Vergessen oder gar idealisieren darf man allerdings nicht, dass diese Art der Partizipation auch mit einigen Nachteilen verbunden ist. So war beispielsweise Carl Zeiss, der Gründer des deutschen Technologieunternehmens „Zeiss“ bereits überzeugt von dem Prinzip des Verantwortungseigentums, nicht aber von dem Genossenschaftsprinzip, da dieses eine häufig wechselnde Unternehmensführung mit sich bringen kann. Genau diese ist bei dem Schweizer Carsharing Unternehmen Mobility, einem der wenigen Beispiele einer Mobilitäts-Genossenschaft, gelebte Realität. Hier müssen Arnd Bätzer und seine Kolleg:innen des Verwaltungsrat jedes Jahr von den Mitgliedern neu gewählt werden. Diese Organisationsform und ihr wertebasierter Ansatz bringen jedoch laut Arnd Bätzer eine andere Haltung mit sich, sowohl gegenüber den Mitarbeitenden als auch gegenüber den Kund:innen. „Dialog schützt vor Arroganz“, so brachte er es auf den Punkt, als ich ihn gefragt habe, was für ihn das Genossenschaftsmodell auszeichnet. „Man braucht viel Wille, zuzuhören. Ohne Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit geht es nicht“. Den Geschäftserfolg von Mobility beweisen deren Zahlen, selbst wenn man das politische Erbe der Schweizer Staatsform als Eidgenossenschaft in der Potentialbewertung ausklammert. Inzwischen stellen sie ihren 224.000 Kunden über 3.000 Fahrzeuge an über 1.500 Standorten in der Schweiz zur Verfügung. Laut ihrem Geschäftsbericht von 2019 betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA) 17,9 Millionen und der Gewinn 1,8 Millionen Schweizer Franken. Ein Franken ist fast so viel Wert wie ein Euro.
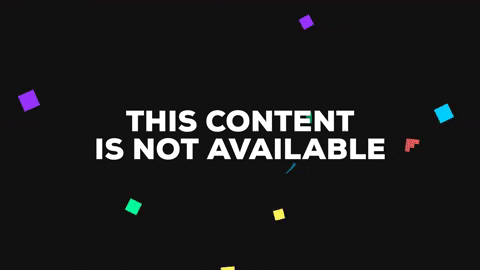
Verbindung ergibt Sinn
Der eigentlich unschätzbare Vorteil dieser Art des Wirtschaftens und der Zusammenarbeit ist aber das Gefühl der Verbindung. Oder um mit Hartmut Rosas Gegenkonzept zur Entfremdung zu sprechen: Sie ermöglicht Resonanz, sowohl mit sich selbst als auch mit anderen. Zur Resonanz kommt es laut Rosa, „wenn wir uns auf Fremdes, Irritierendes einlassen, auf all das, was sich außerhalb unserer kontrollierenden Reichweite befindet. Das Ergebnis dieses Prozesses lässt sich nicht vorhersagen oder planen, daher eignet dem Ereignis der Resonanz immer auch ein Moment der Unverfügbarkeit.“ Überträgt man Rosas Resonanztheorie als Maßstab für ein gelingendes Leben auf unsere politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen, so knirscht es im Gebälk des neoliberalen Wachstumsparadigmas und der Kreis zum Verantwortungseigentum schließt sich. Nicht umsonst ist Hartmut Rosa einer der Direktoren des Kollegs Postwachstum der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
In der Theorie klingt Partizipation häufig wundervoll – in der Realität ist zu viel davon allerdings sowohl in Unternehmen, als auch in öffentlichen Beteiligungsprozessen gefürchtet. Mit Burkhard Horn spreche ich daher in Podcast-Folge 47 über eine neue Mobilitätskultur und den gesamtgesellschaftlichen Diskurs der Verkehrswende als wichtiges Vehikel dorthin. „Ohne Zivilgesellschaft geht es nicht. Wenn man zu viel auf einmal will und es nicht vermittelt, dann kann es auch nach hinten losgehen“, erklärt der freiberufliche Berater und ehemalige Leiter der Verkehrsabteilung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin. „Verkehrswende und Wandel braucht einen moralischen Kompass, aber nicht den moralischen Zeigefinger.“ Mehr über den Wert und die Wirkung von Partizipation und Zusammenarbeit bei der Mobilitätswende könnt ihr hier nachlesen.
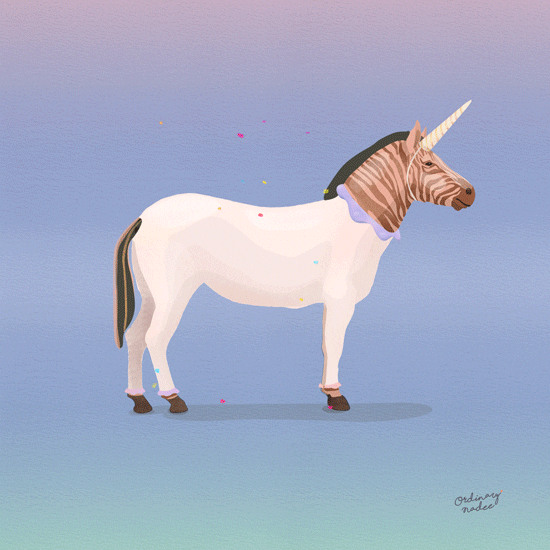
Zebras vs. Einhörner
Was wäre, wenn wir die Hunderte Milliarden Dollar Investitionsvolumen all jener Mobility Start-Ups in genossenschaftlich organisierte Unternehmen und Verbünde stecken würden, ohne diese aberwitzige Einhornjagd? Wie sähen unsere Mobilitätskultur und das Angebot auf den Straßen aus? Welchen Einfluss hätte das auf die Lebensqualität unserer Städte und ländlichen Regionen?
Wenn das Ziel wirklich darin bestünde, urbane und ländliche Mobilität attraktiver, emissionsärmer, günstiger, inklusiver, schöner und innovativer zu gestalten, dann wäre ein Bruchteil dieses Geldes besser in den Händen von Genopreneuren angelegt, wie Boris Janek von der Akademie Deutscher Genossenschaften Unternehmer nennt, die Genossenschaften starten und „die digitale Ökonomie annehmen, den Wandel lieben und die Welt neu zu bauen versuchen. Man stellt den Menschen in den Mittelpunkt und befähigt seinen Kunden, sich selbst zu helfen.“
Die beiden Pioniere Hannes Gassert aus der Schweiz und Trebor Schulz aus den USA wiederum arbeiten an einer Bewegung namens Plattform-Kooperativismus, welche die Sharing Economy neu definieren soll, indem die erfolgreichen und allseits geliebten Modelle von Amazon, Uber, Ebay, AirBnB oder TaskRabbit auf Basis der genossenschaftlichen Prinzipien neu aufgebaut werden. Nur, dass sie nun Fairmondo, Lazooz oder eben Mobility heißen.
Ich gebe zu, beim ersten Lesen überkam mich der Gedanke, wie uncool und wie wenig glamourös dieses Gegenmodell mangels Silicon Valley Tech-Ästhetik im Vergleich zum Plattform-Kapitalismus erscheint, auf Basis dessen Uber und Co. agieren. Ist es nicht erstaunlich und auch gefährlich, wie tief die erst seit wenigen Jahren kursierenden Narrative der Disruption, der Geschäftsmodellinnovation und der Techgläubigkeit bereits verankert sind in unserem Denken?
Doch auf Basis des Plattform-Kooperativismus hätten wir Mobilitätsanbieter, welche basisdemokratisch von Menschen geführt würden, die vor Ort leben und so aus Eigeninteresse an der Erhöhung der Lebensqualität interessiert sind, die motiviert von Wohlwollen und das Gefühl gemeinschaftlicher Verbindung eine neue Kultur des Teilens aufbauen. Statt Verantwortung zu delegieren hieße es selber machen. Hier würden die Fahrer:innen und sogenannten Charger am Gewinn beteiligt werden und hätten ein Mitbestimmungsrecht. Unsere Mobilitätsangebote würden nicht irgendeiner Person im Ausland gehören, die wir auch noch für ihren Unternehmergeist anbeten, sondern den Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass der Dienst funktioniert, und denen, die ihn nutzen gehört. Dadurch entstünde ein enormes Verantwortungsgefühl, das Gefühl der Selbstwirksamkeit und der Partizipation. Es entstünde Verbindung und Resonanz. Aus „Don’t be gentle, it’s a rental!“ würde „Sharing is caring!“. Wäre es all das wert, dafür ein bisschen mehr Komplexität und Langsamkeit in Kauf zu nehmen?
Und mal ganz ehrlich: Wir wollen doch alle nur geliebt werden – und die Wahrscheinlichkeit, von einer Herde zufriedener Zebras geliebt zu werden ist weitaus höher als von wenigen egoistischen Einhörnern.
Unser Gastautor Sebastian Hofer ist getrieben von der Überzeugung, dass wir eine neue, zukunftsfähige und nachhaltige Mobilitätskultur brauchen. Er mag Fahrräder ziemlich gerne und lässt es daher grundsätzlich rollend angehen. Er verfolgt den Ansatz, dass die Mobilitätswende als kollektiver Wandel nur mit individuellem Wandel des Mindsets möglich ist. Achtsamkeit und Zuhören anstatt nur neue Vehikel, Apps und Geschäftsmodelle. Ist dies schon die Quadratur des Rades oder nur der Blick darüber hinaus?
Der Beitrag erschien im Januar auf 1E9
Illustrationen:
Titelbild: Ryoji Iwata
Scooter: Markus Spiske
Rest: Giphy