Die Trennung von Mensch und Natur ist sinnlos. Das demonstriert ein Naturschutzgebiet, das erst durch Müll zu einem solchen geworden ist. Auf in das Ahrensburger Tunneltal.
Nature is dead! Soviel sei gleich zu Beginn gesagt. Dass mich diese Erkenntnis gerade dann trifft, wenn ich auf der Flucht vor der Großstadt und vor meinem stressigen Studentenleben den Weg in die Natur antreten will – geschenkt. Dabei sollten die Akkus doch beim Waldbaden in einem naheliegenden Naturschutzgebiet richtig vollgetankt werden. Endlich der Stadt und ihren Menschen entkommen und einfach mal die Seele baumeln lassen.
Mein Ziel liegt als Kontrast zum ansonsten urbanen Hamburger Randgebiet eingebettet zwischen Siedlungen. Eine vom menschlichen Einfluss befreite Enklave der Natur. Am Ende der letzten Eiszeit lag über dem heutigen Naturschutzgebiet Ahrensburger Tunneltal ein bis zu 300 Meter hoher Eisschild. Als der Gletscher abtaute, formte das abfließende Schmelzwasser ein unregelmäßiges Tal in den Untergrund, das heute von Bruchwäldern, Schilfflächen und Hochmoorresten überwachsen ist. Eine Bahntrasse trennt diese Oase der Natur von einem betonierten Pendler:innenparkplatz mit angrenzender Fast FoodFiliale ab.
Ein Fremdkörper in der Natur
Als ich diese Szenerie betrete, zerstört Müll mein Harmoniebedürfnis. Überall auf dem Parkplatz verstreut liegt Verpackungsmüll aus der FastFoodFiliale. Auf der eisernen Bahnbrücke, dem Fluchtweg in das Naturschutzgebiet, liegen braune Papiertüten, Burgerschachteln und Eisbehälter. Aus einem Plastikdöschen quillt süßsaure Soße und läuft in klebrigen Fäden die Treppenstufen hinab. Der Luftzug der vorbeifahrenden Re gionalbahnen weht den Müll von der Brücke Zug für Zug, Stück für Stück ins Gleisbett. Es bleibt ein Band aus Müll entlang der Bahntrasse zurück; die dreckige Grenze zwischen Siedlungsgebiet und Natur.
Diese Szenerie der Gegensätze, der schwelende Konflikt zwischen Mensch und Natur, der nur durch die Bahntrasse gebändigt zu werden scheint, ist Sinnbild für unsere moderne Naturbeziehung. Wir sind akribisch darauf bedacht, uns in unseren modernen Wissenspraktiken von der Natur abzugrenzen. Während wir die Natur als transzendent, also als eine quasi religiöse übergeordnete, universelle Einheit betrachten, entwerfen wir unsere Gesellschaft als eine subjektive Konstruktion aus sozialen Beziehungen.
Der französische Soziologe Bruno Latour beschreibt unsere moderne gesellschaftliche Verfassung als Wissensstruktur, die durch die künstliche Trennung der kulturellen von der natürlichen Welt geprägt ist.
Natürlichkeit ist kollektive Einbildung
Unsere moderne Gesellschaft versteht die Natur als schützenswerten regelmäßigen und rhythmischen Ablauf, der durch das historische Auftreten des Menschen gestört wurde. Um diesen Ablauf wieder in das vormenschliche Gleichgewicht zurück zu führen, managen wir die Natur, mit dem Konzept der Naturschutzgebiete. Das Ahrensburger Tunneltal dient somit als Abbild einer imaginierten Natur – einer Natur, in die es sich zu fliehen lohnt, um sich für einen Augenblick von unseren zivilisatorischen Problemen zu befreien. Die Natur wird als etwas erdacht, das außerhalb von sozialen Beziehungen verortet ist und somit im Gegensatz zur modernen Großstadt steht. Das Ahrensburger Tunneltal erscheint als Insel der Ursprünglichkeit, als Rückzugsort für Tiere und Pflanzen.
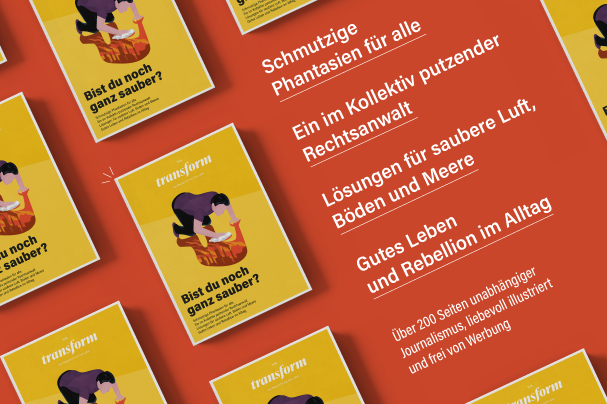
Diese Naturvorstellung beruht jedoch auf einem Bündel sich widersprechender neoromantischer Zuschreibungen. Unsere kollektive Wahrnehmung unterliegt der Einbildung, das Naturschutzgebiet sei dem menschlichen Einfluss und dessen transformativer Kraft entzogen. Dieser Entzug geschieht durch soziale und politische Prozesse: Hunde sind anzuleinen, Menschen müssen auf den angelegten Wegen gehen und der » Eintrag « von Müll ist » explizit « untersagt. Die Natur wird als Gegengewicht
Unsere kollektive Wahrnehmung unterliegt der Einbildung, das Naturschutzgebiet sei dem menschlichen Einfluss und dessen transformativer Kraft entzogen.
zum ansonsten urbanen Raum konserviert. In der Landesverordnung über das Ahrensburger Tunneltal ist festgeschrieben, dass das Naturschutzgebiet der Erhaltung eines beispielhaften, eiszeitlichen Tunneltals diene. Die Natur sei hierfür in ihrer Ganzheit zu erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen. In diesem Spannungsfeld zwischen » ganzheitlicher Natur « und dem sie bedrohenden urbanen Raum sind Fast FoodVerpackungen ein höchst unerwünschter Fremdkörper – noch dazu, wenn sie sich quasi auf der Türschwelle zu eben jener erhaltungswürdigen Natur aufreihen.
Die Fassade der Natürlichkeit bröckelt
Dabei untergraben Wildschweine täglich die Grenze zwischen Mensch und Natur. Sie wandeln auf Wildwechseln zwischen einem dichten Erlenbruchwald und der Bahntrasse. Dort suchen sie in unserem Müll nach Essbarem und schleppen dabei Verpackungen ins Naturschutzgebiet. Unser Einfluss auf das Naturschutzgebiet offenbart sich in einer beigen Tragetüte, eingegraben in eine frische Wühlstelle am Wegesrand. Oder in einem Eislöffel aus Plastik, der halb untergewühlt in einem tief in den Erlenbruch hinein führenden Wildwechsel steckt.
Der Versuch, das Menschliche penibel aus dem Naturschutzgebiet zu entfernen, ist gescheitert. Die einstige glaziale Rinne genießt durch das Vorkommen des streng geschützten Kammmolches den höchsten Schutzstatus auf europäischer Ebene. Dabei ist Biodiversität nicht per se ein Indikator für die Natürlichkeit eines Gebietes, sondern beschreibt oftmals eine fiktive menschliche Naturvorstellung. Diese romantisierte Natur zeichnet sich durch einen möglichst hohen Artenreichtum aus.
Knicks sind künstliche, dicht bewachsene Wallhecken, die als Einfriedung von Feldern landschaftsprägend in Deutschland sind.
Im Ahrensburger Tunneltal werden daher in bestimmten Zeitabständen Knicks, Niederwälder und andere Gehölze von Menschen beschnitten, um sie zu verjüngen und die Natürlichkeit durch charakteristische Arten zu erhalten. Somit werden menschliche Eingriffe vorausgesetzt, um unsere romantische Vorstellung von Natur zu konservieren.
Bereits Karl Marx lehnte eine Trennung von Mensch und Natur ab. Stattdessen erklärte er, dass der Mensch als Teil der Natur auf seine Umwelt einwirke und diese durch seine Körperkraft verändere. Mit der Besiedlung der Erde durch den Menschen würde so immer mehr ursprüngliche Natur transformiert. Es entstünde eine Wechselbeziehung, in welcher sich die Menschen mit der Natur verbinden, bis sich dieser vermeintliche Gegensatz auflöst und vielfältige Gesellschaftsnaturen entstehen. Dabei prägen wir die Struktur unseres Heimatplaneten bis in den letzten Winkel. Eine Natur, unberührt vom menschlichen Einfluss, ist nicht mehr existent. Wir leben im Anthropozän.
Müll schafft Natur
Die komplexen Gesellschaftsnaturen des Anthropozäns zeigen sich auch im Ahrensburger Tunneltal, wo ein Wanderweg die eiserne Bahnbrücke, mit den Überresten einer mittelalterlichen Burganlage – der Burg Arnesvelde verbindet. Der Einfluss des Menschen führt bis zur erste Besiedlung dieses Gebiets durch eiszeitliche Menschen vor etwa 14.000 Jahren zurück. Die späteiszeitliche Rentierjäger:innen brachten den ersten Müll. Nicht nur Essensreste blieben liegen, sondern auch kaputte Geräte und Werkzeuge wurden weggeworfen.
Der Begriff der Gesellschafts- naturen versucht einen Zustand unserer modernen Wirklichkeit zu fassen, in dem natürliche und gesellschaftliche Realitäten nicht mehr getrennt voneinander, sondern vielmehr als zutiefst ineinander verwoben betrachtet werden.
Fast 14.000 Jahre später verhalf dieser eiszeitliche Müll dem Gebiet zu unverhoffter Berühmtheit. Der besagte Wanderweg ist nach dem Archäologen Alfred Rust benannt. In den 1930ern grub er im Ahrensburger Tunneltal Stein, Holz und Knochengerät aus. Damit belegte er erstmals die Anwesenheit der eiszeitlichen Menschen in einem so nördlichen Gebiet. Die Entdeckung machte das Tal unter Archäolog:innen weltberühmt und bewahrte das Gebiet vor der Zerstörung durch Abtorfung, also der Gewinnung von Torf durch Trockenlegen und Abgraben der Moorgebiete. Der eiszeitliche Müll bewahrte dem Kammmolch seinen heutigen Lebensraum.
Die von Rust entdeckten Rentiergeweihe zieren bis heute die untere Hälfte des Ahrensburger Stadtwappens. Die obere Hälfte ziert die ehemalige Burg Arnesvelde, der die Stadt ihren Namen verdankt. Aufgeschüttete Wälle, Gräben, sowie die Burganhöhe zeugen im Tunneltal bis heute von der anthropogenen Überprägung des Gebietes. Diese historischen Überreste der einstigen Burganlage sind als Schuttwälle müllgewordener mittelalterlicher Bausubstanz heute von einem dichten Buchenwald überwuchert und dennoch in ihren Umrissen eine Attraktion des Ahrensburger Tunneltals.
Wir tragen Verantwortung für unsere Gesellschaftsnaturen
Ob Mikroplastik in unseren Meeren oder Genveränderungen in unseren Pflanzen. Überall sind die Spuren des Menschen eingedrungen. Es gibt keine transzendente, uns behütende Mutter Erde mehr. Kein von uns unabhängiges natürliches Gleichgewicht, auf das wir uns berufen können. Naturschutzgebiete sind nicht natürlich und Städte nicht menschlich, sondern durch unsere kulturelle Transformation fest miteinander verwoben. Dies ist nun aber sicherlich keine Aufforderung, euren Müll einfach liegen zu lassen. Ganz im Gegenteil zeigt das Anthropozän, dass wir radikal verantwortlich sind für die Gesellschaftsnaturen, die wir erschaffen.
Text: Jascha Deeken
Bild: Hulki Okan Tabak auf Unsplash
Zur Person
Gastautor:in
Jascha Deeken hat seine Bachelorarbeit an der Uni Kiel über die soziale Konstruktion von Müll geschrieben. Dafür hat er im Ahrensburger Tunneltal geforscht. In seinem Master beschäftigt er sich mit Themen der politischen Ökologie und der politischen Ökonomie.
Quellen
In the nature of cities. Urban Political Ecology and the politics of urban metabolism.
N. Heynen., M. Kaika und E. Swyngedouw,
Taylor & Francis, 2006
Landesverordnung über das Naturschutzgebiet » Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal «
vom 16. August 1982, Schleswig-Holstein





