Foodtrends wie die Low-Carb-Ernährung, das Intervallfasten oder die Clean-Eating-Bewegung scheinen von der Idee des »sauberen« Essens besessen. Woher kommt dieses Bedürfnis, den Körper durch bestimmte Speisen zu reinigen?
Lea verkündet stolz: »Das sind die Toxine, die meinen Körper verlassen«, während sie mir vor dem Biologieunterricht ihre Zunge entgegenstreckt. Als ich mich nach vorne lehne, bemerke ich auf der Oberseite der Zunge tatsächlich einen hellweißen Belag. Mit einem zu friedenen Gesichtsausdruck erzählt sie, dass sie mit dem Fasten begonnen habe, was im Grunde bedeute, dass sie seit Tagen nichts außer etwas Brühe und Wasser zu sich nehme.
Lea und ich sind zu diesem Zeitpunkt siebzehn Jahre alt und gute Freundinnen. Ihre Mutter, die ein paar Tage auf einem exklusiven Fasten-Yoga-Wellness-Retreat verbracht hat und ganz »gereinigt«, so Lea, zurückgekehrt ist, hat sie zur Fastenkur ermutigt. Ihre weiße Zunge ist ihrer Meinung nach ein Beleg dafür, dass die Kur ihren Körper erfolgreich entgiftet. Welche Gifte das genau sein sollen, kann sie nicht sagen. »Das, was sich eben über die Zeit angesammelt hat.«
Jetzt, viele Jahre später, frage ich mich noch immer, was das für Gifte sind, von denen sich Menschen, die von einem bestimmten Ernährungsstil überzeugt sind, befreien wollen. Woher kommt dieses Bedürfnis, sich durch das, was man isst oder eben auch nicht isst, zu reinigen?
Paleo, Keto, Ayurveda
Heilfasten ist beileibe nicht die einzige Ernährungsweise, die verspricht, den Körper von schlechten Einflüssen zu säubern. Ob Low Carb, glutenfreie Ernährung, Veganismus, Paleo, Keto, Ayurveda oder Intervallfasten: In den letzten Jahren schießen Ernährungstrends wie Pilze aus dem Boden und sie alle versprechen » clean «, also sauber und gesund zu sein. Es gibt sogar einen Foodtrend, der ganz explizit als »Clean Eating« bezeichnet wird. Wer sich dem »Clean Eating« verschreibt, meidet Fertigprodukte, Haushaltszucker und ungesunde Fette. Statt mit Zucker wird beispielsweise mit der Süße aus Früchten gearbeitet, Weißmehl wird durch Nussmehl ersetzt und Butter von Kokosöl abgelöst. Als ungesund wahrgenommene Lebensmittel werden also durch ihre »cleanen« Counterparts ersetzt.
Auf diese Einteilung von Nahrungsmitteln in die Kategorien »gut« und »schlecht« trifft man bei allen Ernährungstrends. Für Menschen, die sich außerhalb der Gruppe befinden, die einen bestimmten Ernährungsstil verfolgt, erscheint diese Einteilung oft willkürlich. Warum darf ich bei der ketogenen Ernährung beispielsweise keine Hülsenfrüchte essen, aber bei der Paleo-Diät sind diese erlaubt, obwohl beide auf Proteine abfahren und eine große Schnittmenge mit der Low-Carb-Bewegung haben?
Dass kaum ein wissenschaftliches Feld so widersprüchliche Studien zur gesunden Ernährung liefert wie die Ernährungswissenschaft, macht die Situation auch nicht einfacher. Im Feuilleton der großen Tageszeitungen werden Foodtrends daher oft abschätzig als »Ersatzreligion« bezeichnet und ihre Anhänger:in als eine Instagram-Generation beschrieben, die ihren Ernährungsstil aufmerksamkeitswirksam auf Social Media zur Schau stellt. Diese Foodtrends aber zu schnell als oberflächlich-individualistischen Quatsch abzutun, ist ein Fehler. Denn Regeln dafür, was man essen darf und was nicht, gibt es nicht erst seit der Erfindung der Low-Carb-Ernährung.
Do’s & Don’ts der Ernährung gibt es seit tausenden Jahren
In nahezu allen Religionen der Welt existieren Speisegesetze und Reinheitsgebote, die zwischen erlaubten und verbotenen Lebensmitteln unterscheiden. Im Judentum wird zum Beispiel zwischen koscheren (»tauglichen«) und nicht-koscheren Speisen unterschieden, während der Islam Nahrungsmittel als halal (»erlaubt«) oder haram (»unantastbar«) einstuft. Die Unterschiede werden insbesondere beim Umgang mit Fleisch deutlich: Schweinefleisch ist in beiden eben genannten Religionen tabu, im Hinduismus ist hingegen Rindfleisch verboten, während manche Untergruppen des Buddhismus den Fleischverzehr komplett ablehnen.
Aber auch wenn sich die Speiseregeln zwischen den Glaubensgemeinschaften unterscheiden, so haben sie gemeinsam, dass bereits der Kontakt mit unreinen Lebensmitteln deren Makel auf den Menschen überträgt. Gleichzeitig kann der Genuss von »guten« Speisen einen positiven psychologischen Effekt haben und ein Gefühl von moralischer Säuberung hervorrufen. Besonders deutlich wird das beispielsweise beim christlichen Abendmahl, bei dem Gläubige sich durch den Verzehr von gesegneten Lebensmitteln von ihren Sünden befreit glauben. Reinheit steht dabei immer in Verbindung mit Leben, Unversehrtheit und Integrität. Aber auch Menschen, die heutzutage auf Social Media ihre »cleane«
Frühstücksroutine präsentieren, zeigen damit ihre eigene Disziplin und Integrität auf. Und wenn wir dann doch ungeplant auf einmal die ganze Tüte Chips leer gefuttert haben, sprechen wir im Nachhinein auch verschmitzt davon, »gesündigt« zu haben.
Für Menschen, die den Glaubenssätzen eines bestimmten Ernährungsstils folgen, hängt der eigene Selbstwert eng mit der Einhaltung der Regeln zusammen. Das hängt heutzutage auch mit unserer Vorstellung des idealen Körpers zusammen, die mit unseren Ernährungsregeln eng verknüpft ist.
Das Wort »Diät« kommt von dem griechischen Wort »diaita« und
bedeutet so viel wie Lebensführung, Lebensweise oder Lebensordnung.
Die eigenen Leute finden
Betrachtet man die Speisegesetze der unterschiedlichen Religionen, bemerkt man, dass es keinen roten Faden gibt, nach dem zum Beispiel aus hygienischen Gründen überall auf der Welt die gleiche Nahrung verboten wäre. Da die Linien des Erlaubten und Verbotenen willkürlich gezogen zu sein scheinen, gehen Historiker:innen und Soziolog:innen davon aus, dass Speisegesetze zur sozialen Abgrenzung von anderen Bevölkerungsgruppen dienten. Durch das Festhalten an den eigenen Speisegesetzen konnte so die Identität der Gruppe immer wieder bestätigt werden und es war leichter zu sagen: »Die anderen sind nicht wie wir, sie sind Ungläubige, sie essen Schweinefleisch.« Und so weiter.
Heute leben wir in einer weniger archaischen Welt. Religion und
Speisegesetze nehmen für die meisten Menschen keinen großen Stellenwert mehr ein. Und gleichzeitig tun sie es doch. Wer sich nämlich für einen bestimmten Ernährungsstil entscheidet, dieser Person kann sich eine Gemeinschaft an Menschen eröffnen, die ähnliche Werte und Vorstellungen teilen, wie sie selbst – auch wenn wir hier nicht von einer Religion sprechen können. Wer sich vegan ernährt, wird sich mit anderen Veganer:innen einig sein, dass Menschen Empathie für Tiere empfinden sollten. Wer auf ketogene Ernährung schwört und sich eher auf den optimalen Muskelaufbau konzentriert, identifiziert sich eher mit Menschen, die ähnliche Körperideale vertreten.
»Gesundes« Essen als Essstörung: Wenn das Einhalten der eigenen Ernährungsregeln zum Zwang wird, spricht man von »Orthorexie«. Anders als bei Magersucht oder Bulimie, ist diese Erkrankung aber noch nicht
offiziell als psychische Erkrankung anerkannt.
Wenn ich mich an die Szene mit Lea während meiner Schulzeit zurückerinnere, weiß ich noch, wie ich von Leas Erklärung nicht überzeugt war und während des Unterrichts darüber grübelte. Es erschien mir unlogisch, dass ausgerechnet die Zunge Gifte ausscheiden sollte. Würde der automatische Schluckreflex dem nicht entgegenwirken? Ich machte mir Sorgen, ob ihre weiße Zunge nicht ein Zeichen dafür war, dass die Fastenkur sich schädlich auswirkte. Sie schien allerdings fest entschlossen, weiter durchzuhalten. Ich entschied mich, meinen Biolehrer nach der Unterrichtsstunde unter vier Augen zum Thema der weiße Zunge zu befragen. Er hatte sich bereits einige Male kritisch zu Ernährungstrends geäußert. Er wusste sicher Bescheid.
Ein lukrativer Markt, der unsereSehnsüchte spiegelt
Ernährungstrends bieten einen profitablen Markt, in dem viele Produkte (zum Beispiel »cleane« Superfood-Bowls) und Dienstleistungen (wie Ayurveda-Retreat, persönliches Ernährungscoaching etc.) angeboten werden können. Ganz im Sinne des kapitalistischen Mechanismus kommen immer wieder neue Trends hinzu, die die alten ablösen und damit neuen Bedürfnissen der Konsument:innen entsprechen. Dabei ist es schon fast ironisch, dass es zum Geschäftsmodell einiger Food-Trends gehört, Ängste zu lindern, die wir der Industrialisierung der Lebensmittelbranche verdanken.
Anhänger:innen des Clean Eatings besinnen sich auf »die gute alte
Zeit« zurück, in der das Leben vermeintlich besser, die Zutatenlisten übersichtlicher und die Lebensmittel natürlich und unverarbeitet waren. Hannah Frey, die den Trend aus den USA in Deutschland mitgeprägt hat, beschreibt Clean Eating als »Kochen, wie es Oma und Opa getan haben«. Wenn ich mich an die Kochkünste meiner Oma zurückerinnere, war da allerdings viel Butter und einiges an Maggi-Würze im Spiel. Gesund war das wahrscheinlich nicht, köstlich war es trotzdem.
Wie Weizen den Menschen
domestizierte: Der Historiker Yuval Harari schildert in »Eine kurze Geschichte der Menschheit«, wie sich die Menschen durch die Kultivierung von Weizen selbst zu knechten begannen. Dabei idealisiert er die Lebensbedingungen von Jäger:innen und Sammler:innen. Seine Ablehnung von gezüchtetem Weizen passt gut zur
Paleoernährung, deren Anhänger:innen dem Anspruch folgen, sich wie Steinzeitmenschen zu ernähren.
Wir können bei beiden Trends beobachten, dass es eine Sehnsucht nach einer vermeintlich natürlicheren Zeit gibt, als es noch kein gentechnisch verändertes Gemüse oder Pestizide auf den Äckern gab. Auch Fasten-Fans beziehen sich gerne auf unsere prähistorischen Vorfahren. Die Erklärung: Menschen mussten damals automatisch fasten, wenn sie zeitweise keine Nahrung finden konnten. Es sei also nur natürlich für uns und unsere Körper, es auch heute zu tun. Skeptiker:innen könnten darauf antworten, dass unsere Ur-ur-ur-ur… – Großeltern in solchen Situationen des unfreiwilligen Verzichts wahrscheinlich auch mangelernährt waren – aber wir wollen hier keine Haare spalten.
Dabei ist es schon fast ironisch, dass es zum Geschäftsmodell einiger Food-Trends gehört, Ängste zu lindern, die wir der Industrialisierung der Lebensmittelbranche verdanken.
Zwar gibt es keine Langzeitstudien, die beweisen, dass man beim Fasten »entschlackt« oder »entgiftet«, aber es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass das Fasten andere positive gesundheitliche Auswirkungen haben kann: Der Blutdruck sinkt und Serotonin wird ausgeschüttet, was zu einem sogenannten » Fasten-High« führen kann. Es ist sogar möglich, dass sich die Struktur unserer Zellen durch moderates Fasten verbessert. Tierversuche weisen darauf hin, dass Krebszellen durch Fasten »ausgehungert« würden. Es fehlen aber noch langfristige Studien, um diese Hinweise wissenschaftlich zu bestätigen.
Zurück zu Lea und ihrer Fastenkur. Ich fing nach dem Unterricht meinen Biologielehrer ab und schilderte ihm die Situation, ohne dabei ihren Namen zu nennen. Er erklärte, dass die weiße Ablagerung auf der Zunge aus einem Mix aus abgestorbenen Zellen und Essensresten bestehe und beim Kauen automatisch abgetragen werde. Ohne feste Nahrung werde der Belag immer dicker und weißer, weil die Reibung im Mund fehle und nicht, weil der Körper vermeintliche Gifte abstößt. Lea habe ich das nie gesagt. Das Fasten hat sie kurze Zeit später sowieso beendet. Sie hatte Hunger bekommen.
Fasten vs. Intervallfasten: Es gibt unterschiedliche Spielarten des Fastens: Beim
Heilfasten nach Buchinger etwa sind während eines bestimmten Zeitraums von mehreren Tagen nur Wasser, Brühe und Säfte erlaubt. Bei Menschen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, Fasten nur unter Aufsicht einer Ärzt:in vorzunehmen. Intervallfasten hingegen soll in den Alltag integriert werden und hat oft auch die Gewichtsreduktion zum Ziel. Hierbei wird regelmäßig tage- oder stundenweise keine Nahrung mehr aufgenommen.
Text: Dora Midré
Illustration: Simone Goder
Weiterlesen
Food Report 2022: Die österreichische Ernährungswissenschaftlerin und Foodtrend-Forscherin Hanni Rützler prognostiziert, was uns in puncto essen in Zukunft wichtig sein könnte. (Zum Artikel)
Media
Foodtrends von 1900 bis heute: Was wir für gesunde Ernährung halten, hängt von den vorherrschenden Werten unserer Zeit ab. Die Journalist:innen von Quarks zeigen in einem Video eine Übersicht der Ernährungstrends der letzten 100 Jahre. (Zum Video)
Der zeitreisende Ernährungswissenschaftler: Wovor würde uns ein Zeitreisender warnen?Klimakatastrophe, Weltverschwörungen, feindliche Übernahme durch Aliens? Weder noch. In diesem
Sketch ist der Zeitreisende von Beruf Ernährungswissenschaftler und will das Paar, das er besucht, vor ungesundem Essen warnen. (Zum Video)
Quellen
Eine kurze Geschichte der Menschheit: Yuval Noah Harari ist Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem. In diesem Buch schildert er mit kritischem Blick die Evolution der Menschheit und wie sie sich erst vor 70.000 Jahren zum Schrecken der Ökosysteme entwickelte. Yuval Noah Harari, Pantheon Verlag, 2015


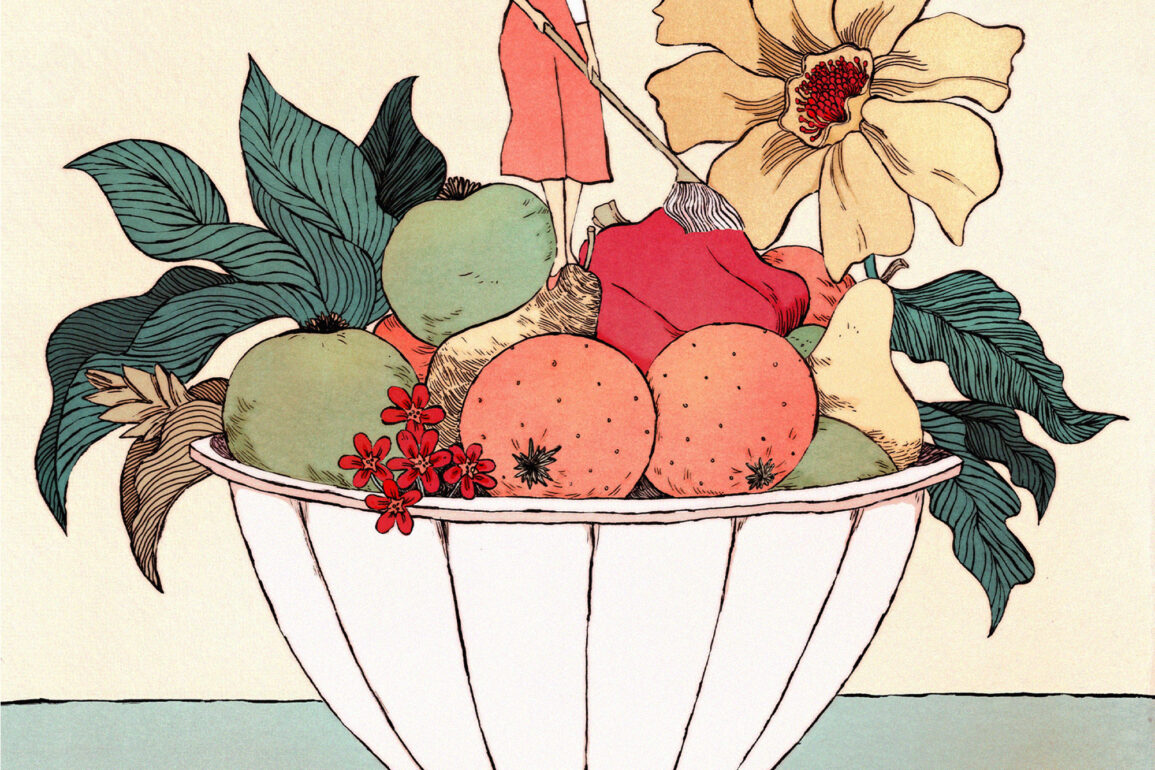



Schreibe einen Kommentar