Deutschland fordert mehr Kinder von AkademikerInnen. Und zeigt sich zugleich besorgt darüber, wer angeblich zu viele Kinder produziert.
Demografischer Wandel heißt das Zauberwort. Was wird aus der Rente? fragt die FAZ. „Deutschland wird immer älter, klagt die ZEIT. Die Botschaft ist klar: Kinder soll man bekommen, damit sie im Alter für einen sorgen. So macht man das weltweit, ohne Rücksicht darauf, unter welchen Bedingungen diese Kinder zur Welt kommen. Sind sie erst einmal da, müssen die Eltern selbst sehen, wie sie sie ernähren. Dagegen bleibt Familien in Deutschland weitaus nicht alles selbst überlassen – was so manchen konservativ denkenden Menschen schwer empört.
Denn die demografische Forderung ist hier eine andere: Nicht die Kinder sollen die eigenen Eltern pflegen, sondern lieber arbeiten gehen und das Wirtschaftswachstum fördern, damit die Renten sicher sind und professionelle Pflegekräfte (unter-)bezahlt werden können. Das führt zu einigen Widersprüchen.
Einerseits sind ja diese Kinder und diese Renten idealerweise für alle da. Gleichzeitig sollte es volkswirtschaftlich egal sein, wessen Kinder in das Rentensystem einzahlen. Das würde bedeuten, dass alle die Unterstützung der Gesellschaft verdienen, um Eltern werden zu können. Andererseits möchten gerade in Deutschland die Eltern gerne in Ruhe gelassen werden, weil nur sie entscheiden wollen, was das Beste für ihr Kind ist.
Gerade weil das sozialstaatliche Eingreifen in die Familien mit großem Misstrauen betrachtet wird, interessieren sich die Menschen umso mehr dafür, welche Familien denn Kinder haben dürfen, welche angeblich zu viele haben, welche mal mehr haben sollten und warum. Darum ist – gerade in Deutschland – die Tendenz stark, zu fordern: Redet den Eltern nicht rein, sie sind die Keimzelle der Gesellschaft, lasst sie ihre Werte pflegen! Aber was für Werte sind das? Welche Eltern will das Land?
Eines Tages, es ist nun schon ein paar Jahre her, schob eine Autorin dieses Textes einen Zwillingskinderwagen durch eine dieser typischen Fußgängerzonen dieser typischen westdeutschen Kleinstädte. In dem Wagen schliefen zwei bezaubernde, blonde kleine Jungs. Ein älterer Herr blieb, auf einen Stock gestützt, vor ihr stehen und blickte wohlgefällig und gerührt auf die Brut herab. Sie war schon im Begriff, ihn anzulächeln. Da streckte er zeigend die Hand aus, die nicht auf den Stock gestützt war, und verkündete: „DAS ist Deutschlands Zukunft!“
Wie sollte Deutschlands Zukunft (nicht) aussehen?
Eine weit verbreitete Sorge um diese Zukunft wird akkurat von Rainald Grebe auf den Punkt gebracht, wenn er singt: „Schuld sind nur die deutschen Akademikerinnen, die keine Kinder kriegen wollen oder können.“ Angeblich bekämen nämlich, so klagt das deutsche Feuilleton seit Jahrzehnten, hochqualifizierte Frauen zu wenig Kinder. Damit, so heißt es, bedrohen sie nicht nur das Rentensystem, sondern auch Deutschland als Innovations- und Wirtschaftsstandort sowie das Überleben des „deutschen Volkes“.
Dementsprechend groß war die Erleichterung vieler, als neue Zahlen 2017 belegten, dass die deutschen Akademikerinnen ihren Gebärpflichten doch mehr nachkommen als befürchtet.
Es wird dabei eine Korrelation zwischen dem Bildungsstand der Eltern und dem wirtschaftlich verwertbaren Potenzial der Kinder angenommen. Den bildungsbürgerlichen Müttern wird eine besondere Rolle zuteil: Sie vermitteln, so die allgemein anerkannte Wahrheit, ihren Kindern nicht nur Fürsorge und Tischmanieren, sondern auch Bildung.
Sie lesen, malen und singen mit ihnen, gehen zum Capoeira, auf den Kinderbauernhof und sorgen für die musikalische Früherziehung. Dazu haben allerdings Akademikerinnen nicht immer Lust, denn es verträgt sich schlecht mit ihren Arbeitszeiten. Vor die Alternative gestellt, mit ihren Kindern Fingermalerei zu üben oder bis spätabends in Konferenzen zu sitzen, entscheiden sich viele für Letzteres – dazu haben sie schließlich mal ihren Hochschulabschluss erworben. Obendrein gilt es auch noch, die Hausarbeit zu bewältigen, die ihnen nach wie vor selten abgenommen wird. Wir können es den deutschen Akademikerinnen schwerlich verdenken, wenn sie diese eher undankbare Dreifachbelastung nicht schultern wollen. Eher ist es erstaunlich, dass so viele es tun.
Fluch der Bildungsferne
Und die anderen Mütter? Von ihnen nimmt man gemeinhin an, dass sie ihre Kinder vor den Fernseher setzen, um ihnen die letzten Reste der ohnehin kärglichen Denk- und Empathiefähigkeiten zu ruinieren, und sie dann raus auf die Straße schicken, wo sie sich zu Banden zusammenrotten und die teuren Jacken und Handys der Bildungsbürgerkinder klauen. Zusammengefasst werden all diese Annahmen im vernichtenden Urteil “Hartz-IV-Kinder”. Ihnen wird weitaus weniger Begeisterung entgegengebracht.
Bildungsfernes Gebaren und eingeschränkte Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden so sicher vererbt wie der heimische Dialekt, so die Grundannahme: Klar können sich manche den Hartz-IV-Dialekt mit großer Disziplin, Konzentration oder Ortswechseln abtrainieren, aber los werden sie ihn nie ganz und spätestens in der Heimat verfallen sie schnell wieder in alte Sprachmuster. Dieser Klassismus ist an sich schon schwer vereinfacht und wird zu einer toxischen Mischung, wenn er etwa von Thilo Sarrazin mit Rassismus vermengt wird.
Die bürgerliche Sorge, dass Menschen mit Migrationshintergrund „bildungsferne Eltern“ abgeben, werden oftmals nur in Form von Andeutungen nach einer Flasche Wein geäußert. Man hat ja nichts gegen Ausländer, wünscht sich aber eben die Zuwanderung qualifizierter und studierter Menschen, die sich ohne Probleme wirtschaftlich verwerten lassen und den viel beschworenen Fachkräftemangel abdämpfen – während sie gleichzeitig in die Rentenkasse einzahlen. Noch beliebter sind steuerzahlende Super-MigrantInnen-Eltern, die sich derart „integrieren“, dass sie sich kaum mehr von „biodeutschen“ Eltern unterscheiden lassen.
Denn neben der Angst, dass das Vorhandensein oder Fehlen von Bildungschancen vererbbar ist, gibt es eine weit verbreitete Furcht vor „völkischer Verdrängung“, zukünftig „zahlenmäßig unterlegen“ zu sein. Diese wird nicht nur in rechten Medien vertreten. Das gegenseitige Aufrechnen von Menschengruppen geschieht bei scheinbar nüchternen Debatten über die vermeintlich explodierende Geburtenrate von Menschen mit Migrationshintergrund, bei Gesprächen zum Bevölkerungswachstum in Ländern des Globalen Südens. Gerne wird es dabei mit dem Hinweis versehen, dass ja auch die Gefahr besteht, diese vielen Menschen könnten sich auf den Weg nach Europa machen. Alle. Was dann?
Nehmen wir nun einmal die Ängste dieser besorgten BürgerInnen ernst. Dazu müssen wir uns allerdings vorstellen, Politik sei nicht für die Menschen da, damit diese ihr Potential realisieren und ein gutes Leben führen können. Wir müssen dazu annehmen, es sei umgekehrt. Wir müssen so denken, als seien die Menschen eine Verfügungsmasse, um den Wohlstand einer privilegierten Norm zu sichern.
Um diese sogenannten „Ängste“ ernst zu nehmen, müssen wir also von einem humanistischen Menschenbild abweichen. Selbst unter diesen menschenverachtenden Annahmen wären die besagten Ängste allerdings fehlgeleitet.
Drei Gegenargumente
Zum einen korreliert laut einer Studie im Wissenschaftsjournal Nature steigender Wohlstand nicht unbedingt mit sinkenden Geburtenraten. Hat die akademisch gebildete Familie nämlich erst einmal ein teures Haus gebaut, das mehr Ressourcen verschlungen hat als ein komplettes südindisches Dorf, so neigt sie eher dazu, selbiges mit drei oder mehr Kindern zu füllen. Denn erst ab einem bestimmten Wohlstandsniveau haben sie das Gefühl, sich Kinder wieder leisten zu können.
Ebenso wie die Zahl der MigrantInnen muslimischen Glaubens und ihrer Kinderschar von vielen höher geschätzt wird als sie ist, ist auch die Zahl der Geburten von wohlhabenden, „biodeutschen“ Kids längst nicht am Abfallen, sondern vielmehr am Steigen. 2016 betrug der Anteil der Kinderlosen unter den 40- bis 44-jährigen Akademikerinnen 25 Prozent. Das sind nicht nur drei Prozentpunkte weniger als 2012, sondern soll auch ein Anzeichen für eine Trendwende sein.
Zum anderen gibt es keinen direkte Zusammenhang zwischen der Höhe und Organisationsform der Rente einerseits, und der Anzahl der Beitragszahlenden andererseits. Es ist der politische Wille, der bestimmt, ob es eine Mindestrente gibt. Was die Rentenfinanzierung betrifft, so wird in Zukunft entscheidend sein, ob die Früchte der Digitalisierung und Automatisierung auch die Sozialsysteme stützen – beispielsweise durch eine Automatisierungssteuer.
Schlussendlich ist das Grundproblem also nicht, dass die „falschen“ Eltern Kinder bekommen. Vielmehr sollte darüber nachgedacht werden, warum eigentlich die Bildung und Herkunft der Eltern in Deutschland für die ihrer Kinder derart entscheidend ist.
Laut einer Studie der OECD, des Staatenverbundes der Industrienationen, von 2016 schafft es in Deutschland nur jede zehnte Person, deren Eltern nicht über einen höheren Bildungsabschluss verfügen, die Fachhochschule oder Universität abzuschließen. Von den insgesamt 35 OECD-Ländern schneiden dabei nur sechs Staaten noch schlechter ab als Deutschland.
Eine chancengleichere Gesellschaft könnte so aussehen, dass alle Kinder ihre Potenziale ausschöpfen können. Das würde bedeuten, dass Kindern, die es etwas schwerer haben, geholfen wird. Dann müsste man sich auf diese Art der sozialdarwinistischen Diskussionen, wer denn nun Kinder bekommen soll, gar nicht erst einlassen. Tatsächlich ist der Lebensweg heute schon im jüngsten Alter stark vorgezeichnet.
Zwar gibt es immer einzelne Positivbeispiele, doch ein Großteil benachteiligter Kinder bleibt auch im Erwachsenenalter benachteiligt – und wird dann noch verurteilt und bekommt den Hinweis, doch bitte nicht allzu viele Kinder zu bekommen.
Was wollen wir für Kinder tun?
In der gleichen Studie kritisiert die OECD, dass, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), Deutschland weniger Geld in sein Bildungssystem investiere als andere Staaten: Mit 4,2 Prozent liegt Deutschland unter dem OECD-Durchschnitt von immerhin 4,8 Prozent. Doch gerade Investitionen in die Bildung könnten dabei helfen, dass zahlenverliebte VolkswirtInnen „Hartz-IV-Kinder“ mit und ohne Migrationshintergrund genauso betrachten würden wie „biodeutsche“ Kinder von AkademikerInnen.
Eine Gesellschaft, die weniger stark diskriminiert und sortiert, wäre die erste Voraussetzung dafür. Praktisch würde das bedeuten, Investitionen nicht in Elite-Studiengänge zu versenken. Stattdessen könnten wir uns entscheiden, außerschulische Aktivitäten, einen guten Betreuungsschlüssel und Ganztagsschulen zu finanzieren, die das übernehmen, was so manche Eltern vielleicht nicht leisten wollen oder können. Das würde natürlich auch bedeuten, mehr LehrerInnen, SozialpädagogInnen und ErzieherInnen einzustellen und auszubilden.
Letztendlich ist es also eine Frage des politischen Willens. Der entscheidet nämlich darüber, welche Unterstützung gesellschaftlich für alle Eltern und ihre Kinder bereit gestellt wird. Diese Kinder sind die Kinder von uns allen. Ihre Eltern lieben sie und wollen das Beste für sie. Es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie das Beste bekommen.
Text: Viola Nordsieck & Marius Hasenheit
Illustration: Julia Beutling
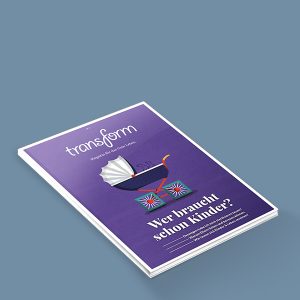 Dieser Text ist Teil der vierten Ausgabe vom transform Magazin, das im Dezember 2017 erschienen ist. Neben dem Hauptthema „Kinderkriegen“ werden hier auch Ideen einer gerechteren Wirschaft oder den Vorzügen von Bademänteln besprochen.
Dieser Text ist Teil der vierten Ausgabe vom transform Magazin, das im Dezember 2017 erschienen ist. Neben dem Hauptthema „Kinderkriegen“ werden hier auch Ideen einer gerechteren Wirschaft oder den Vorzügen von Bademänteln besprochen.




