Tagtäglich bewegen wir unseren Körper – und das mit großer Selbstverständlichkeit. Doch was passiert, wenn Arme und Beine auf einmal nicht mehr mitmachen? Und lassen sich Körperfunktionen wieder erlernen?
Sabine Ehrig drückt die Hand ihres Mannes – das kann sie schon wieder. Auch wenn es sie sichtlich anstrengt. Die Hand wieder lösen, das klappt noch nicht. Die 54-Jährige hatte einen Schlaganfall. Sie sitzt mit ihrem Mann Markolf im Wohnzimmer ihres Einfamilienhauses am Berliner Stadtrand und erzählt, wie es dazu kam. Es ist ein Nachmittag im November vor zwei Jahren, die pensionierte Musiklehrerin arbeitet im Keller am Computer. Sie merkt, wie ihr auf einmal das Tippen schwerer fällt. Sie kippt vom Stuhl und kommt nicht mehr hoch. Auch zum nur wenige Zentimeter entfernten Telefon schafft sie es nicht. »Ich lag da wie ein Käfer auf dem Rücken, also völlig hilflos«, sagt Ehrig heute. Währenddessen wartet Markolf Ehrig auf einer Party von Freunden auf seine Frau, doch sie kommt nicht, geht auch nicht ans Telefon. Irgendwann fährt er nach Hause. Als er sie findet, liegt sie schon seit fast acht Stunden auf dem Kellerboden. Notarzt, Krankenhaus, dann die Diagnose – Schlaganfall. Ein Teil der Halsarterie war geplatzt. Ein Blutgerinnsel bildete sich und wanderte ins Gehirn, verstopfte dort die Blutbahn. Bis zu vier Stunden nach solch einem Schlaganfall kann ein Medikament verabreicht werden, welches das Gerinnsel auflöst.
Bei Ehrig ist es dafür zu spät, sie muss sofort operiert werden. Mit einem Katheter, der ihr in die Leiste eingesetzt wird, wird das Gerinnsel im Gehirn zerstoßen. Die Operation ist erfolgreich, Ehrigs linke Körperhälfte aber bleibt gelähmt – eine sogenannte Halbseitenlähmung. Über die genaue Ursache für den Schlaganfall sind sich die Ärzte bis heute unsicher.
Wie fühlt sich das an, sich plötzlich nicht mehr so bewegen zu können, wie man es gewohnt war? »Es ändert sich alles mit einem Schlag«, sagt Ehrig. Es seien vor allem Selbstverständlichkeiten, die man nicht mehr machen könne – Buchseiten umblättern, die Zahnpasta aufschrauben, mit Messer und Gabel essen. Manche Körperfunktionen kommen relativ schnell zurück: Die ersten zaghaften Schritte kann die damals 52-Jährige schon nach drei Wochen wieder machen. »Dass man überhaupt wieder aus dem Rollstuhl rauskommt, das ist schon gut«, sagt sie. Von alleine geht das natürlich nicht. Schon zwei Tage nach der Operation beginnt die erste Reha. Und noch heute, zwei Jahre später, bestimmen die verschiedenen Therapien ihr Leben. Jeden Tag steht etwas Anderes auf dem Plan: Drei verschiedene Physiotherapien, zwei Ergotherapien, chinesische Akupunktur, Ayurveda, zahlreiche Arzttermine. Und zuhause geht es weiter, auch dort trainiert sie täglich Arm, Hand und Bein.
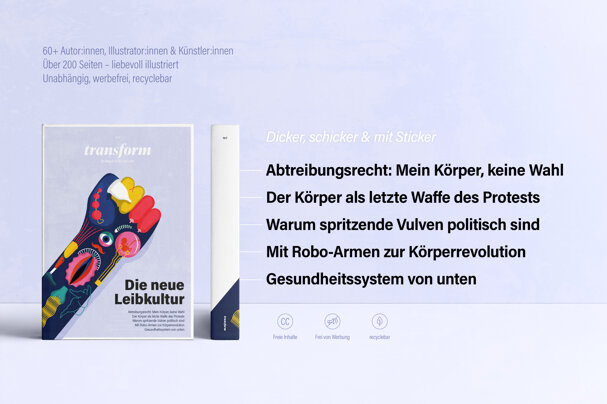
Der Arm ist nicht tot
Zum Beispiel mit der Spiegeltherapie: Markolf Ehrig hält seiner Frau einen Spiegel seitlich vor die Körpermitte, so dass ihr linker Arm vom Spiegel verdeckt ist. Sie hebt den gesunden rechten Arm und betrachtet das Spiegelbild: Es sieht aus, als bewege sich der gelähmte linke Arm. »Das Gehirn wird überlistet – im positiven Sinne«, erklärt der Neurologe Thomas Mokrusch. Er ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation und war bis zu seinem Rentenbeginn letztes Jahr Chefarzt zweier neurologischer Reha-Zentren. Nach einem Schlaganfall setze eine Negativ-Bewegung ein: Der Patient versucht das gelähmte Körperteil zu bewegen, aber es funktioniert nicht, und irgendwann merkt sich das Gehirn, dass sich nichts tut. »Dieses Negativ-Lernen wird mit der Spiegeltherapie verhindert, es wird dem Gehirn gezeigt ›schau mal, du kannst das ja‹.« Der Effekt ist nicht nur mental, sondern auch spürbar: Ehrig kann den Arm zwar nicht bewegen, spürt aber ein Kribbeln in der Hand, wenn sie das Spiegelbild sieht. Und auch sonst fühlt sie heiß, kalt und warm. »Der Arm ist ja nicht tot«, kommentiert ihr Mann. Wo liegt dann das Problem? Es ist die Verbindung zum Gehirn. Bei einem Schlaganfall bekommen die betroffenen Hirnzellen keinen Sauerstoff – je länger das andauert, desto mehr Zellen sterben ab. Oder anders formuliert: Je schneller ein Schlaganfall behandelt wird, umso geringer sind die bleibenden Schäden. »Time is brain«, sagen Neurologen deshalb.
Aber auch danach ist nicht alles zu spät: Die Folgen eines Schlaganfalls, wie zum Beispiel Ehrigs Halbseitenlähmung, sind nicht grundsätzlich irreversibel. Körperfunktionen lassen sich – zumindest teilweise – wieder erlernen. Laut Mokrusch kann sogar eine fast vollständige Besserung eintreten – wenn nicht zu viele Gehirnzellen kaputt sind. Er erklärt das so: »Im Zentrum des Geschehens ist das Risiko am größten, dass Zellen absterben und unwiederbringlich verloren sind. Aber in der Umgebung gibt es Gehirnzellen, die nur in eine Art Schlaf geraten. Diese können wieder angeregt werden und neu lernen.« Außerdem könnten andere Hirnregionen aushelfen und Funktionen der ausgefallen Zellen übernehmen. Denn »die Gehirnzellen sind in ein Netzwerk eingebunden«, so der Neurologe. Dieses Netzwerk muss aktiviert und stimuliert werden. Dazu dienen Ehrigs viele Therapien und Übungen, das tägliche Training, die Spaziergänge mit ihrem Mann. Das elektrische Stimulationsgerät, mit dem sie täglich zuhause die Armmuskeln anregt oder das motorbetriebene Bewegungsgerät, das einem Ergometer ähnelt. »Wir versuchen alles«, sagt Markolf Ehrig. Nicht ohne Grund: Laut Mokrusch macht die Kombination verschiedener Methoden und das repetitive Üben der Bewegungen den Erfolg der Rehabilitation aus.
Roboter und Virtual-Reality
Aber noch etwas spielt eine große Rolle: die Motivation des Patienten. Körperfunktionen wiederzuerlernen ist ein zäher Kampf. Sabine Ehrig erlebt Fortschritte: Schon ein Jahr nach dem Schlaganfall schafft sie es zur Hochzeit des Sohnes nach Frankreich, sie kann wieder, wenn auch noch unsicher, laufen, und meistert mit einem elektrischen Rollstuhl auch größere Strecken. Dann tritt sie wieder auf der Stelle oder macht ein paar Schritte rückwärts: Weil der gesunde Arm überstrapaziert wurde, muss sie mit Krankengymnastik gegensteuern, auch mit der Beweglichkeit des gelähmten Arms geht es nur sehr langsam voran. Es sind Momente der Frustration. »Ich hab gar keine Lust mehr auf so ein Leben wie es gerade ist«, hört man sie in solchen Augenblicken sagen. Aber dann macht sie doch weiter, kämpft sich Stück für Stück vorwärts.
»Jeder gute Therapeut unterstützt deshalb auch psychologisch«, sagt Mokrusch. Dazu gehöre Lob und Rückmeldung. Zum Beispiel so, wie die Therapeutin im ›Walk Again‹-Rehazentrum in Berlin-Mitte Sabine Ehrig lobt: »Das sieht sehr gut aus. Ich mein, wenn’s perfekt wär, wären Sie ja nicht hier.« Ehrig bewegt scheinbar mühelos ihren gelähmten Arm und steuert damit ein fliegendes Männchen auf dem Bildschirm vor ihr, eine Art Computerspiel. Der Arm ist in eine Schiene eingespannt, die zu einem robotergestützten Armtrainer gehört. Das Gerät entlastet ihn von seinem Gewicht, verschafft Ehrig so einen leichten Arm, die Bewegung geht aber, mit der noch vorhandenen Muskelaktivität, von ihr aus. Das ist ein großer Vorteil der robotergestützten Therapie, erklärt Susanna Imbriani, die ergotherapeutische Leiterin des Zentrums: »Durch den robotischen Arm kann man in der Therapie die Bewegung unter Gewichtsentlastung repetitiv durchführen. Wir könnten als Therapeuten die Bewegung nicht so oft wiederholen und das Gewicht nicht so gezielt und präzise entlasten.« Zweimal die Woche nimmt Ehrig diese besondere Behandlung in Anspruch, um die Muskeln zu stärken und das Gehirn zu stimulieren.
Robotergestützte Therapie – das klingt nach Zukunft und Science-Fiction, ist aber noch lange nicht alles, was möglich ist. Große Hoffnungen setzt Neurologe Mokrusch beispielsweise in die virtuelle oder augmented, computerverstärkte, Realität. Die Patient:innen könnten dann mithilfe einer Virtual-Reality-Brille Bewegungen üben, die sonst so nicht möglich sind – für Mokrusch »eine Zukunftstherapie«. Sie auch in die Praxis umzusetzen, daran arbeiten mehrere Start-ups weltweit. Aber auch was die neurologische Rehabilitation generell, das Wiedererlernen von Körperfunktionen, betrifft, ist der Experte zuversichtlich: »Die Grenzen sind noch nicht ausgelotet.«
»Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben«, sagt Sabine Ehrig nach ihrer Therapie-einheit. Mit ihrem elektrischen Rollstuhl macht sie sich auf den Weg zur nächsten U-Bahn-Station. Nach einem kurzen Stopp zuhause wird sie noch einmal aufbrechen, dieses Mal aber nicht zur Therapie, sondern zum Sprachkurs. Da einer ihrer Söhne in Frankreich lebt, lernt sie Französisch.
Text: Alexander Wenzel
Bild: Frieda Hornbach
Quellen
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Infos zum Thema Schlaganfall, u.a. Entstehung, Ursachen und Folgen.
tfmag.de/strokehelp | schlaganfall-hilfe.de
Mit virtueller Realität zurück ins Leben finden
Wie die Virtuelle-Realität-Technologie Patient:innen nach Schlaganfällen helfen kann.
tfmag.de/rehub | fr.de
Media
Schlaganfall – Jede Minute zählt
Arte-Doku zum Thema Schlaganfall.
tfmag.de/jedeminute | youtube.com




