In Finanzkollektiven teilen sich Menschen ihr Geld außerhalb von Kleinfamilie und Partnerschaft. Die Mitglieder schmeißen ihre Einnahmen in einen Topf und nehmen sich was sie brauchen. Wie geht das gut?
Das eigene Geld mit anderen zu teilen, scheint für viele zunächst widersinnig. Schließlich hat man dafür hart gearbeitet! Oder einfach gut geerbt? Die Mitglieder der Finanzcoop (FC) wollen mit gemeinsamer Ökonomie die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus ausgleichen, indem sie ihr Geld zusammenlegen und sich nach Bedarf nehmen. Auslöser für das Finanzexperiment war ein gemeinsamer Museumsbesuch, als die FCler noch Mitbewohner*innen einer gewöhnlichen Göttinger WG waren. Was für die einen eine ganz normale Freizeitbeschäftigung war, konnten sich andere nicht leisten – und es war auch nicht Teil der Sozialisation. Die Mittel, die wir zur Verfügung haben, bestimmen schließlich, was für ein Leben wir führen können.
Die FC besteht mittlerweile seit über zwanzig Jahren. Zu den sieben Erwachsenen haben sich vier Kinder gesellt. Das Kollektiv lebt nicht mehr zusammen in Göttingen, sondern an vier Orten in ganz Deutschland verteilt. Ihr Geld teilen sie trotzdem noch. Dafür zahlen alle ihre Einkünfte auf ein gemeinsames Konto ein. Alle vier bis sechs Wochen verbringt die FC ein Wochenende zusammen und diskutiert anstehende Fragen. Über ihre Erfahrungen haben die sieben ein Buch geschrieben und damit andere für die Idee begeistert. Zum Beispiel eine Gruppe aus Dresden.*
*Diese Stadt und alle Namen von Personen in diesem Artikel wurden von der Redaktion geändert.
Gleich und gleicher
Die Einnahmen und Ausgaben,
die den täglichen Bedarf
abdecken, fasst man unter
Alltagsökonomie zusammen.
Hier teilen sich vier junge Menschen ihr Geld. Sie sind begeistert von der Idee, Solidarität und Revolution im Alltag zu leben. Beim ersten Treffen wurde den vier schnell klar, dass ganz schön viel dranhängt am Thema Geld. Da landet man ganz fix bei Fragen wie: Welche Rolle spielt Geld im eigenen Leben? Mit wie viel Geld fühlt man sich sicher? Für welche Dienstleistung oder Tätigkeit wird wie viel bezahlt und ist das eigentlich gerecht? » Wir reden gar nicht so viel über Geld, sondern über die Tätigkeiten, die wir machen wollen «, erklärt Lena. Sie und ihre Mitstreiter*innen versuchen, ihren Alltag so zu strukturieren, dass mit den zusammengelegten Einnahmen die Bedürfnisse aller erfüllt werden können. Bisher funktioniert das ganz gut, » wir sind in der glücklichen Lage nicht jeden Cent umdrehen zu müssen «, sagt sie.
» Wir reden gar nicht so viel über Geld, sondern über die Tätigkeiten, die wir machen wollen. «
Damit nicht einige Kollektivmitglieder am Ende des Tages doch gleicher sind als die anderen, ist es eigentlich sinnvoll, auch mitgebrachtes Vermögen, anfallende Erbschaften, und vorher entstandene Schulden zu kollektivieren. » Es geht darum, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Sich nicht im Einzelkämpfermodus durchzuschlagen, « so Lena. Weil es aber doch ein großer Schritt ist, das gesamte Vermögen mit anderen zu teilen, haben sich die Dresdner*innen eine Übergangsfrist gesetzt. Sie fangen mit einer Probezeit an, und wollen dann noch einmal über das Thema Vermögen sprechen.
Analog zur Alltagsökonomie bezieht die Vermögensökonomie alle Ersparnisse und Schulden mit ein.
Die FCler haben es so gelöst, dass das Vermögen zwar noch den Einzelnen gehört, jedoch nicht ohne Absprache mit den anderen ausgegeben werden kann. Zudem muss es nach gemeinsam festgelegten Kriterien angelegt werden, und erwirtschaftete Zinsen gehen an das Kollektiv. In vielen Wohnprojekten gibt es Regelungen, wonach das Vermögen über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg langsam in das Kollektiv überführt wird. Hier sind geteilte finanzielle Ressourcen an das Zusammenleben geknüpft. Deshalb gibt es oft einen Ausstiegsvertrag, der regelt, was bei einem Auszug mitgenommen wird.
» Es geht darum, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Sich nicht im Einzelkämpfermodus durchzuschlagen. «
Gemeinsame Ökonomie Light
Es gibt unzählige Ansätze von gemeinsamer Ökonomie, kurz auch Gemök genannt. In einer abgespeckten Version zahlen alle Mitglieder etwa nur einen Teil ihres Einkommens in den gemeinsamen Topf. Neben bedürfnisorientierten Modellen gibt es auch Projekte bei denen allen die gleiche Summe ausgezahlt wird – quasi ein gruppen- finanziertes Grundeinkommen.
Wem das alles zu viel Verpflichtung ist, kann es mit der LightVariante versuchen , wie sie eine WG in Berlin seit ein paar Jahren betreibt. Aktuell ist die Gruppe zu dritt. Auch sie teilen sich ihr Geld solidarisch miteinander, allerdings mit wenig Aufwand und ohne das Ganze als wirklich langfristiges Projekt zu denken. Sie haben ihre » Gemök « an den Berliner WG-Alltag angepasst: Mal steigen Mitbewohnerinnen aus, mal zieht je mand neues ein und wird auch in das Finanzkollektiv aufgenommen. Die drei Mitbewohnerinnen zahlen von ihren Privatkonten die Miete und ihre regelmäßige Ausgaben wie die Beiträge für die Krankenkasse. Was dann noch übrig bleibt, landet als Bargeld in einer kleine Holzbox im Flur. Aus der können sich dann alle bedienen. Jede*r weiß, wie viel die anderen ein zahlen. Über die Ausgaben wird kein Buch geführt. Nur bei größeren An schaffungen über 100 Euro sprechen sich die Gruppenmitglieder ab.
Für größere Ausgaben und schlechte Zeiten haben die Berlinerinnen trotzdem ein kleine Spardose angelegt. Besonders viel ist da aber nicht drin. Zwar kommen Merle, Johann und Jule gerade gut über die Runden, eine weitere Person mitfinanzieren können sie aber nicht. Anders sieht es in Dresden aus. Als es zum Studienbeginn zu stressig wurde, konnte Sara aufhören, nebenbei für Lohn zu arbeiten, und sich vollständig auf ihre Ausbildung konzentrieren. Für andere Kollektivmitglieder war es in der Vergangenheit selbstverständlich, sich im Studium finanziell auf die El tern verlassen zu können, jetzt teilen die Dresdnerinnen ihre Privilegien. Für Sara ist das neue selbstgesponnene finanzielle SupportNetz ein Luxus, den sie vorher so nie hatte.
Insgesamt ermögliche der kollektive Umgang mit Geld, dass sich alle für Tätigkeiten entscheiden können, » ohne finanziellen Druck « , so die Dresdner*innen. Das ermöglicht auch politische Arbeit. Zwar hat sich die politische Kultur seit der griechischen Polis weiterentwickelt, trotzdem macht auch heute ein gesicherter Lebensunterhalt politische Arbeit und Aktivismus einfacher. Wer nicht so viel für Lohn arbeiten muss, hat mehr Zeit sich für Dinge zu engagieren, die nicht mit Geld wertgeschätzt werden.
In der griechischen Polis hatten nur Männer, die ein Stück Land besaßen, die Möglichkeit, an Volksversammlungen teilzunehmen und damit politisch wirken zu können.
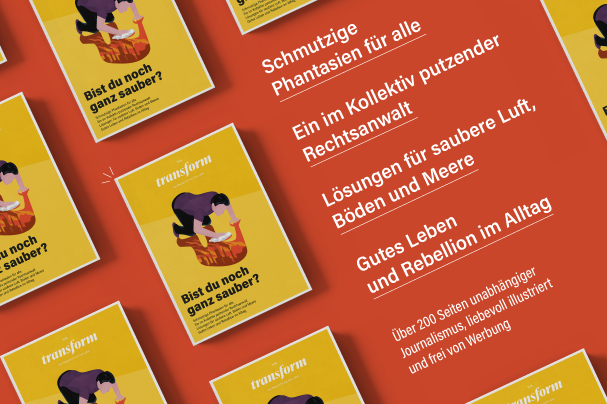
» Man macht sich einmal nackig, aber dann hat man geklärt wo man steht, und es macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied. «
Reden ist Gold
Damit gemeinsame Ökonomie funktionieren kann, ist gute Kommunikation und Reflexion gefragt. Über Geld zu sprechen ist in vielen Kreisen verpönt. » Man macht sich einmal nackig « scherzt Merle, » aber dann hat man geklärt, wo man steht, und es macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied. « Ganz abschütteln lassen sich Einkommensunterschiede jedoch nicht immer. Sie selbst gibt am wenigsten in die gemeinsame Kasse, gerade am Anfang war sie deshalb darauf bedacht, nicht mehr zu nehmen als sie selbst einzahlt. » Das hat sich mittlerweile aber etwas gelegt « erklärt sie. Auch Geldausgeben will gelernt sein.
Individuelle Bedürfnisse und Konsumverhalten werden durch Sozialisation, Lebensstil und das soziale Umfeld geprägt. Während der eine den Cocktail für 8 Euro als relativ normale Ausgabe empfand, schlugen die anderen Kollektivmitglieder in Dresden eher die Hände über dem Kopf zusammen. Ein ähnliches Konsumverhalten vereinfacht vieles. » Wir gehen alle nicht viel shoppen «, erklärt Lena. Gemeinsame Ökonomie muss aber nicht Verzicht bedeuten. Gerade die Mitglieder der FC betonen immer wieder, dass es im Gegenteil darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu gehört auch, anderen Bedürfnisse einzugestehen, die sich von den eigenen unterscheiden.
Sozialhilfeleistungen orientieren sich am Einkommen und Vermögen der Bedarfsgemeinschaft. Nach § 7 des Sozialgesetzbuch zweites Buch sind damit Kinder, Eltern und Partner*innen gemeint. Auch Personen, die Verantwortung füreinander tragen und über Einkommen und Vermögen des anderen verfügen können, gehören dazu – das bezieht sich jedoch eigentlich auf Partnerschaften.
Bei solidarischen Finanzkonzepten geht es auch nicht um Kontrolle. » Mir guckt ja niemand auf die Finger « sagt Jule aus der Berliner WG, dementsprechend fühlt sie sich auch nicht in ihrer Autonomie eingeschränkt. Auch die Dresdener*innen haben sich auf ein grundsätzliches » Ja « zu reflektiertem Konsum geeinigt und setzen auf gegenseitiges Vertrauen. Trotzdem funktioniert gemeinsame Ökonomie nur, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn alle Kollektivmitglieder gleichzeitig einen neuen Laptop bräuchten, kämen alle drei Gruppen finanziell ins Straucheln. Kritisch wird es auch in Fragen, bei denen unterschiedliche Moralvorstellungen aufeinander treffen. Sollen mit dem gemeinsamen Geld Flugreisen finanziert werden? Da gibt es Redebedarf!
» Es ist einfach nicht in der Vorstellung eines deutschen Bürokraten, dass sich Menschen außerhalb der Familie ihr Geld teilen «
Kollektive und der Vater Staat
Im Umgang mit Behörden, Banken und Versicherungen ist in solidarischen Ökonomien manchmal Kreativität gefragt. » Es ist einfach nicht in der Vorstellung eines deutschen Bürokraten, dass sich Menschen außerhalb der Familie ihr Geld teilen « bemerkt Johann. Ob es dabei um Sozialhilfeleistungen, gemeinsame Altersvorsorge oder einfach nur ein geteiltes Bankkonto mit mehr als einer » Partnerkarte « geht, vieles in unserer Gesellschaft ist auf Individuen, Ehepaare oder höchstens die Kernfamilie als Bezugsgruppe ausgelegt. Dabei können Finanzkollektive mit Freund*innen finanzielle Abhängigkeiten in Partnerschaften verringern. Wenn neben den Bedürfnissen nach emotionaler Zuneigung und sexueller Befriedigung nicht auch noch langfristige finanzielle Absicherung in romantischen Paarbeziehungen erfüllt werden muss, könnte das Beziehungen entlasten.
» Gemeinsame Ökonomie ist keine Quantenwissenschaft, einfach mal ausprobieren! «
Wie der Name es schon sagt, geht es bei Finanzkollektiven um Geld. Aber eigentlich geht es um viel mehr als das. Es geht um Bedürfnisse, und die Mittel, die man hat, um das Leben, das man führen will, zu verwirklichen. Es geht um Solidarität, die Wertschätzung von Tätigkeiten und ein unter stützendes Miteinander. Damit bricht gemeinsame Ökonomie mit den
Grundzügen des Kapitalismus, in dem jede*r für sich selbst zu sorgen hat, und das gegen alle anderen. Das erfordert Umdenken, Flexibilität und vor allem eine Gruppe, der man vertraut. Das Konzept passt sicher nicht in alle Lebensentwürfe, erfordert Zeit und das Aufgeben von Freiheiten. Gleichzeitig kann es Sicherheit geben und damit auch Freiheiten ermöglichen. » Gemeinsame Ökonomie ist keine Quantenwissenschaft, « schließt Merle, » einfach mal ausprobieren! «
Text: Svea Busse
Bild: Pauline Kohlhase
Weiterlesen
Finanzcoop oder Revolution in Zeitlupe. Von Menschen, die ihr Geld miteinander teilen.
FC Kollektiv. Büchner Verlag, 2019.
transform-magazin.de/riz
Handeln
Solidarnetz
Netzwerk von solidarischen Bezugsgruppen, das viele Ressourcen zum Thema gemeinsame Ökonomie zusammengestellt hat und Vernetzung und Erfahrungsaustausch organisiert.
solidarnetz.org/
Media
Video
Die Philosophin Eva von Redecker spricht mit der Humboldt-Universität zu Berlin in fünf kurzen Videos über Eigentum, Geschlechterverhältnisse und alternative Konzepte.
transform-magazin.de/yt11





