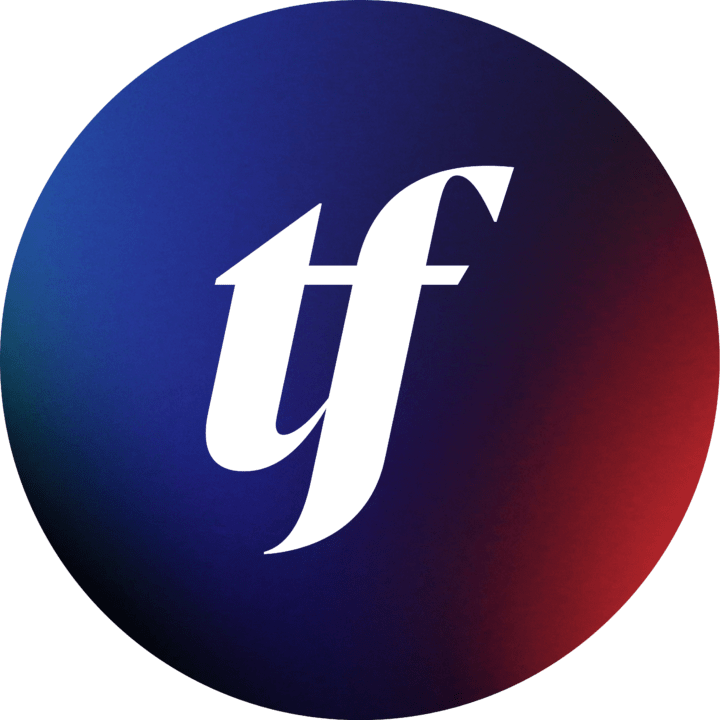Alle Jahre wieder! Plötzlich ist Dezember und in vielen Köpfen verdrängt eine Frage alle anderen Gedanken: „Was schenken?“
Nach Antworten suchen nicht wenige, indem sie in den Fußgängerzonen durch den Dauerregen von Geschäft zu Geschäft eilen. Die Kassen des Einzelhandels klingeln vorweihnachtlich. Das Geschäft mit dem Schenken ist ein wichtiger Faktor der kapitalistischen Jahresbilanz. Und eigentlich doch auch ganz schön, die Idee der uneigennützigen Gabe.
Seit einigen Jahren zwicken mich jedoch ein paar Aversionen gegen diesen zwischenmenschlichen Brauch, und das, obwohl ich selbst liebend gerne anderen Geschenke mache. Mein Problem mit dem Schenken liegt eher im beschenkt werden: Ich würde behaupten, dass ich, wie die meisten Menschen westlicher Zivilisationen, kaum neue Dinge brauche, die sich eignen, verpackt unterm Weihnachtsbaum zu liegen. Das Schenken ist von der materiellen Not entkoppelt. Und doch halten wir an diesem Ritual fest und suchen oft krampfhaft nach Gaben, die irgendeinen Sinn und Zweck haben sollen, oder zumindest ästhetisch ansprechen.

Ästhetik und Nützlichkeit werden jedoch bekannter Maßen nicht von allen Menschen gleich eingeschätzt und wahrgenommen. Das Schenken erfordert Empathie. Und darin liegen sowohl der Zauber als auch der Schreck des Geschenke-Machens. Einfach zu schenken, womit man selbst gern bedacht würde, wäre man in der Situation des*der anderen, greift zu kurz. Es drängt den Empfangenden, meist unbewusst, die eigenen Normalitäten und Werte auf. Jemandem ein aktuelles Smartphone zu vermachen, der ein abgenutztes Mobiltelefon älteren Jahrgangs nutzt, weil man sich selbst gar nicht mehr vorstellen kann, ohne seines zu leben, könnte auch ganz schön nach hinten losgehen: Vielleicht stößt dieser Akt auf freudige Dankbarkeit über den Innovationsimpuls.
Vielleicht löst er aber auch Bedrängnis aus. Der Mensch, dem man eigentlich etwas Gutes tun wollte, ist in der Bredouille: Denn der Verzicht auf ein dauerhaft präsentes Touchscreen-Device könnte auch bewusst entschieden worden sein, als Ablehnung der unmenschlichen Produktionsprozesse, der eingebauten Obsoleszenz oder der dauerhaften Präsenz des Digitalen. Dem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul? Doch was, wenn er den Vorstellungen der Auspackenden massiv entgegen steht?
Die Situation ist für alle Beteiligten denkbar unangenehm. Der/die eine merkt natürlich, dass nicht überschwängliche Jubelschreie die Reaktion sind. Unter verhaltenem Lächeln schimmern Enttäuschung und das Gefühl, nicht verstanden worden zu sein.
Geschenke abzulehnen ist uns Menschen jedoch naturgemäß unangenehm: In der Ablehnung eines Geschenks schwingt auch die Ablehnung der Beziehung mit. Marcel Mauss schreibt dazu: “Das Geben zu verweigern, es zu verabsäumen, den anderen einzuladen, ist wie auch die Weigerung, etwas anzunehmen, gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung. Es bedeutet, das Band der Allianz und Gemeinsamkeit zu zurückzuweisen.“ [1] Die/der Beschenkte steht zwischen der Aufrichtigkeit sich selbst und der/dem Gebenden gegenüber.
Als höfliche Ausrede bleibt vielleicht die Notlüge: „Wie lieb von dir, aber das habe ich schon.“ Angenehm ist anders. Dabei sollte das Schenken doch schön sein. Walter Schmidt sieht im Schenken „Akte der Kommunikation“. Darin zeigen wir, wie gut wir andere kennen, verstehen, uns in sie hinein versetzen können. Es ist eine Art, Wertschätzung zu zeigen. Und kaum etwas ist wohl schöner, sowohl für Schenkende als Empfangende, als ein gelungenes, überraschendes Geschenk von Herzen. Doch die meisten Geschenke unter deutschen Tannenbäumen kommen eher wie Erledigungen daher.
Laut Jaques Derrida, darf „Damit es ein Geschenk ist, keine Gegenseitigkeit, keine Erwiderung, kein Austausch, kein Gegengeschenk und keine Schuld bestehen.” Ich würde behaupten, davon sind wir weit entfernt. Denn das Schenken zu bestimmten Anlässen kommt einer sozialen Verpflichtung gleich. Wer ihr nicht nachkommt, muss fürchten, Enttäuschung zu ernten.
In manchen zwischenmenschlichen Beziehungen ist das Schenken gar zum Tauschhandel geworden. Das Geschenk als Investment, von dem sich ein gleichwertiges Gegengeschenk erhofft wird. Oft ein Missverständnis, denn auch das Beschenkt-werden will gelernt sein: Spüre ich, dass der*die Schenkende schlicht Freude daran hat, mich zu beschenken, ist das größte Gegengeschenk vielleicht schlicht die Freude darüber. Wer mehrfach negative Erfahrungen mit dem Schenken gemacht hat, kann zwei Schlüsse ziehen:
1. Geschenke auf Bestellung.
Wenn vorher klar kommuniziert wird, worüber man sich freute, kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. So geht dem Schenken jedoch der Reiz der Überraschung verloren. Empathie wird, ebenso wie beim gemeinen Geldgeschenk, auch nicht gefördert. „Geld heißt, ich kann bezahlen und muss dann keinen Gedanken mehr an meinen Mitmenschen […], kein gegenseitiges Kennenlernen, kein lebendiger Austausch, der zum natürlichen Ineinanderfließen von Bewegungen der Abhängigkeit und der Wertschätzung führt.“ so Charles Eisenstein.

Hat mensch für sich die Nicht-Notwendigkeit der weiteren Anhäufung materieller Güter erkannt, zieht man den folgenden Schluss.
2: Lassen wir das mit dem Schenken doch einfach.
Die Soziologin Elfie Miklautz nennt das einen „Nichtangriffspakt, man lässt sich gegenseitig in Ruhe mit dieser sinnlosen Verpflichtung.“
Aber auch das ist gar nicht so einfach. Unwohl wird den meisten Menschen bei dem Gedanken, an Weihnachten ein Geschenk zu empfangen, ohne mit einem Gegengeschenk seine reziproke Wertschätzung auszudrücken. Dabei ist laut Eisenstein „Das Geschenk eines anderen voll und ganz anzunehmen, […] eines der wichtigsten Geschenke, die wir machen können.“ Vielleicht kommt ja, unabhängig von dem Gefühl, in der „Schuld“ der Schenkenden zu stehen, irgendwann der Impuls und die Idee für ein erwiderndes Geschenk. Vielleicht auch nicht. Mensch übe sich in Gelassenheit, auch bei der Gabe. Um dem Teufelskreis der Pflichtgeschenke zu entrinnen.
Auf der anderen Seite mache Mensch nur Geschenke, die er*sie auch wirklich machen will, um selbst nicht mit der Erwartung auf ein Gegengeschenk Druck auszuüben.
Schön wäre es, nicht das Schenken abzuschaffen, sondern die Verpflichtung dazu.Von Herzen schenkt, wer gibt, woran er selbst Freude hat, sich aber trotzdem fragt, ob der/die Beschenkte sich ebenfalls darüber freut. Ich schenke leidenschaftlich gerne selbstgemachte Köstlichkeiten, muss mich aber doch immer wieder fragen, ob darauf in der weihnachtlichen Futterzeit überhaupt noch jemand Lust hat. Oder wird das Knoblauch-Öl zum ungenutzten Steh-rümchen, die Pralinen zu unerwünschtem Hüftgold? Geht es um meine Freude am Machen oder die Freude der Beschenkten?
So muss ich also auch reflektieren, ob es den von mir beschenkten Menschen vielleicht ähnlich geht wie mir. Vielleicht fühlen sie sich bedrängt, eingeengt, oder sind genervt? Und sagen es aus Höflichkeit genauso ungern wie ich?
Noch eine andere Möglichkeit: Ich schenke, dir, dass du etwas gutes getan hast. Eine Ziege für ein Dorf südlich der Sahara. Die Finanzierung einer Jahresration Futter für einen Hund im nächsten Tierheim. Das wäre entgegen dem Hin- und Herschieben von Scheinen zwischen Vollverdienenden durchaus eine Möglichkeit, Sinn zu stiften. Es kann Gesprächsstoff beim Weihnachtsessen liefern und Beschenkte können Größe zeigen, sich über ein solches Geschenk aufrichtig zu freuen. Ich kenne allerdings (bisher) weder jemanden, der derart beschenkt wurde noch geschenkt hat.
Statt uns zwanghaft Dinge verpacken zu wollen, könnten wir uns stattdessen auch dazu entscheiden, Zeit zu schenken. Zu allererst durch bewusste Präsenz, wenn wir in den letzten Wochen des Jahres, die als einige wenige noch kollektiv dem Arbeitsfetisch entzogen sind. Smartphone aus, Gegenüber an.
Darüber hinaus sind auch geteilte Erlebnisse ein schönes Geschenk. Der gemeinsame Museums-, Theater- oder Kinobesuch, Spaziergang, Wanderung, Frühstück. All das, was man gern, aber viel zu selten gemeinsam macht. Planung, Auswahl und Initiative als Geschenk, an dessen Ergebnis man sich auch selbst erfreut. Als Schenkende sollten wir uns also bemühen, nur dann zu Schenken, wenn wir wirklich Lust und Freude daran haben und uns etwas Schönes einfällt. Nieder mit Verpflichtung und Zwang!
Für Beschenkte ist es immer gut, einfach keine Erwartungen zu haben, das gut gemeinte zu sehen, und dafür dankbar zu sein, aber mit freundlicher Bestimmtheit zu sagen, dass man, in meinem Fall mit ressourcenintensivem Nippes, nicht glücklich zu machen ist. Schon um sich gegenseitig eine Wiederholung dieser Situation zu ersparen. Und in manchen Situationen tut’s auch eine Prise Humor und Leichtigkeit:
Ich werde meiner Oma nie übel nehmen können, dass sie, um „nicht nur Geld zu schenken“, alle Jahre wieder die Tombola-Gewinne der letzten Sparclub-Auszahlung verpackt. Ich drück sie dann, kichere in mich hinein, wir trinken Schnaps und lachen. Zwei Wochen später ist der Umsonstladen um ein Stück reicher. Vielleicht wird es ja mitgenommen von den Organisierenden der nächsten Sparclub-Tombola.
[1] Marcel Mauss: The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. Trans. W.D. Halls. W. W. Norton and Co., 2000, Seite 13.
Titelbild: Unsplash CC.00//Andrew Neel
Übrigens ein Super-Geschenk: www.transform-magazin.de/bestellen/