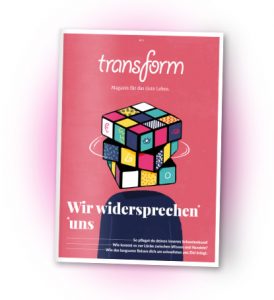Wir alle verstricken uns in Widersprüche, bei unserer politischen Haltung genauso wie bei unserer Lebensführung. Aber ist das wirklich schizophren? Unsere Gastautorin hat ein paar Ideen, wie wir ohne diese Anschuldigung miteinander kommunzieren können.
Unsere Welt ist widersprüchlich
Wir redeten gesellschaftskritisch daher und kamen uns sehr klug vor. Wir sprachen vielleicht über Bi-Feindlichkeit oder Antisemitismus, über Landgrabbing oder über nationale Grenzen im Besonderen und über das Monstrum Kapitalismus im Allgemeinen, in dem wir leben und vermutlich auch noch eine Weile leben werden, denn diese Gesellschaft ist – soweit waren wir uns einig – beschissen. Und nicht nur das: Sie ist voll von inneren Widersprüchen. Sie ist gegen sich selbst gerichtet, da sie fleißig daran arbeitet, ihre eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Die Menschen, die in ihr leben, tendieren dazu, von Selbsthass zerfressen zu sein, um in diesem zerstörerischen System funktionieren zu können.
Einem Selbsthass, den sie nach außen auslagern, der sich gegen das Fremde, das Andere, gegen die schwächsten Glieder der Gesellschaft richtet. Soweit waren wir bis zu diesem Zeitpunkt intellektuell vorgedrungen. Und wir waren relativ zufrieden mit uns, berauscht vom Rotwein, der universitären Atmosphäre oder der Bequemlichkeit unserer Szeneblase. Da spürtest du den Drang, unsere so wohl gewonnene Erkenntnis in drei kurzen und einem langen Wort zusammenzufassen. Der Satz, den ich schon oft hören musste und nicht zum letzten Mal gehört haben werde: „Das ist so schizophren!“
Ich konnte nicht mehr stillsitzen und nein, das war nicht mein ADS. Aus meinem Inneren kroch eine grantelige Kreuzung aus akademischer Feminist*in, psychologischer Halb-Expert*in und widerwärtiger Besserwisser*in hervor und garstete dir zu.
- Der Begriff „Schizophrenie“ bedeutet nicht, was du denkst.
- Hör verdammt noch mal auf, psychische Diagnosen als schicke Metaphern für deine Gesellschaftskritik zu benutzen, denn:
- Das betrifft reale Menschen.
Du verzogst dein hübsches Gesicht und begannst, dich zu rechtfertigen. Ich wisse ja, wie du es gemeint habest, ich solle nicht so auf ein einziges Wort achten, und im Übrigen sei es tatsächlich ein großes Problem, dass viele Menschen gar nicht wüssten was Schizophrenie bedeute, woraufhin du es mir (unzutreffend) erklärtest.
Ich erläuterte dir also, was das Wort Schizophrenie im Wortsinn („gespaltene Seele“), sowie als psychische Diagnose bedeutet (Tipp: Hat nix mit multiplen Persönlichkeiten zu tun), wie sich das Alltagsverständnis des Begriffes und die Diagnose deutlich voneinander unterscheiden, und dass es sicherlich „nur ein Wort“ ist. Aber eines, das konkrete Personen betrifft, denen es nicht gerade zuträglich sein dürfte, dass die Diagnose, mit der sie fremdbezeichnet werden oder sich selbst bezeichnen, so inflationär metaphorisch verwendet wird. Und das auch noch falsch!
Auch in den Geisteswissenschaften scheint es vielen angebracht, die innere Widersprüchlichkeit einer Theorie nicht einfach als solche zu benennen, wirkt es doch viel aparter, von der „Schizophrenie“ dieser Theorie zu sprechen. Ganz zu Schweigen von den Poststrukturalisten Deleuze und Guattari, die schizophrene Menschen gleich als das neue revolutionäre Subjekt stilisierten, das sich komplett über gesellschaftliche Regeln und Konventionen hinwegsetzen könne. Solche Lektüre hinterlässt wohl leider auch Spuren im Sprachgebrauch mittelmäßig belesener Drittsemester-irgendwas-mit-Kultur-Studis. Aber bitte, falls es dir hilft, probier es doch mal mit „Selbsthass“, ein aufschlussreiches Konzept. Oder halt einfach mal den Ball flach: „innere Widersprüche“.
Ach, und jetzt sitzen wir hier. Du hast die Nase voll von linken Akademiker*innen, geschweige denn Feminist*innen, die jedes Wort, was du in den Mund nimmst, in gesellschaftliche Zusammenhänge stellen möchten, über die du noch nicht nachgedacht hast, und dich so hilflos und ohne Sprache zurücklassen. Honey, I’ve been there. Aber es gibt Metaphern, die sind passend, und es gibt unpassende. Viele Metaphern sind gemacht, um zu verletzen.
Andere sind ungewollt diskriminierend. Aber ich hab‘ vor ein paar Jahren schon gelernt, dass es sowohl hochgradig unzutreffend, als auch hochgradig verletzend ist, zu sagen, meine Hausaufgaben seien „voll schwul“. Und genau das gleiche gilt leider auch für deinen schicken Schizophrenie-Vergleich, auch wenn das Wort ein bisschen komplizierter klingt und so schön intellektuell.
Lass uns also über „Verrücktheit“ reden.
Nein genauer: über deinen Blick darauf. Es geht mir nämlich nicht um dieses oder jenes Wort, sondern um eine generelle Haltung psychischen Diagnosen gegenüber. Da paart sich gern schlichtes Unwissen über die Bedeutung eines Wortes mit dem voyeuristischen Gafferblick der „Normalen“ . Dieser Blick kann zwei Formen annehmen: Die Eine sehnt sich nach dem psychischen Anderen, dem Nicht-Vernünftigen in einer rationalisierten Gesellschaft.
Was aus der Reihe tanzt, Abgründe offensichtlich macht, was verwirrt, ihre Grundsätze infrage stellt – alles, was in allem total spannend, aufregend und revolutionär ist – solange es ihr nicht zu nahekommt. Die Andere bringt ihre Abneigung gegen eine bestimmte Art menschlichen Verhaltens zum Ausdruck, indem sie ihn als Diagnose formuliert, sei es nun Autismus oder ADHS.
Zu dieser Mischung gesellt sich gerne ein komplettes Desinteresse für die reale Situation von einer bestimmten Diagnose Betroffener. Zu spüren meist dann, wenn sich nach einer entsprechenden Äußerung doch mal eine betroffene Person zu Wort melden sollte und ihr klargemacht wird, dass es um ihre tatsächliche Diagnose ja nun überhaupt nicht ging.
Sicher – bei vielen Diagnosen handelt es sich um ein stärkeres Vorhandensein einer menschlichen Eigenschaft. Es liegt in der Natur der Diagnoserichtlinien in diesem Gesundheitssystem, möglichst viele grundlegende menschliche Eigenschaften als Diagnosen zu formulieren, um für jede therapiebedürftige Person auch eine Diagnose parat zu haben. Schöne Beispiele dafür sind Konstrukte wie „Zyklothymie“: Eine stark abgeschwächte Form einer bipolaren Störung, die besagt, dass sich bei betroffene Personen, nun ja, häufiger gute und schlechte Stimmungen abwechseln.
Diagnosen beinhalten also oft generelle menschliche Eigenschaften. Was läge da näher, als die Diagnose als schicke Metapher für diese Eigenschaft zu benutzen?
Auch hier gilt:
- Du hast dich nicht eingehend damit beschäftigt? Du hast diese Diagnose nicht, du hast nicht Psychologie studiert und noch nicht mal den Wikipedia-Eintrag dazu gelesen? Dann steht die Chance nicht schlecht, dass dieses Wort nicht das bedeutet, was du denkst. Deine Metapher geht möglicherweise komplett daneben, und die Tatsache, dass die meisten Leute im Raum das nicht merken werden und „schon wissen was du meinst“, macht es nicht besser.
- Sei respektvoll! Denn:
- Das betrifft reale Menschen. Es könnte sein, dass sie dir egal sind, weil du vielleicht keine kennst oder das zumindest glaubst. Wahrscheinlich ist, dass neurodiverse Menschen dich als spannendes Zerrbild deiner eigenen Gefühle interessieren, aber viel weiter eigentlich auch nicht. Die Chancen stehen nicht mal schlecht, dass unter den Menschen, die neben dir sitzen, Betroffene sind, auch wenn du dir das Bild, was du dir vorgestellt hast, sehr viel exotischer und abstrakter ausgemalt hast.
Interessant am gesamtgesellschaftlichem Umgang mit Minderheiten ist ja häufig eine Spaltung der Minderheit in der öffentlichen Wahrnehmung in – im weitesten Sinne – gute Minderheit und böse Minderheit. Die gute Bisexuelle, die in einer festen Beziehung lebt und die böse Bisexuelle, die mit jeder UND jedem ins Bett springt. Der gute Schwule, der gerne heiraten möchte und der böse Schwule, der ohne Gummi ficken will. Die guten Migrant*innen, die Migration begrenzen möchten, und die bösen Migrant*innen, die… arbeiten? Oder nicht arbeiten?
Ich weiß gar nicht, was böser ist. Die guten Geflüchteten vor Krieg, die bösen Geflüchteten vor Armut. Die gute Schwarze Frau, die bei rassistischen und sexistischen Witzen gleichermaßen mit lacht und die böse Schwarze Frau, die sie als solche benennt. Und so weiter. Hier geht es, damit keine Missverständnisse entstehen, um gesellschaftliche Zuschreibungen und Bilder. Diese Bilder sind natürlich bei jeder Menschengruppe sehr unterschiedlich und auf keinen Fall einfach auf eine andere zu übertragen.
Wie ist es bei Menschen mit psychischen Diagnosen? Es ist natürlich aufgrund der krassen Heterogenität dieser Gruppe nicht einfach zu sagen.
Eine der Trennungen, die meiner Erfahrung nach bei der öffentlichen Wahrnehmung neurodiverser Menschen eine Rolle spielt, ist folgende: unterschieden wird zwischen den „spannenden Verrückten“ und den „schlimmen, anstrengenden Verrückten“. Als Sonderfall noch die „Unauffälligen“, die, deren Diagnose du zwar kennst, aber leicht ignorieren kannst und wenig davon mitbekommst.
Die „spannenden Verrückten“: Der Typ aus Fight Club oder der aus Memento. Jeder verrückte Professor in irgendeinem Film oder Buch. Van Gogh und andere „verrückte“ Künstler*innen oder Schriftsteller*innen. Dr. Strangelove. Diese Kategorie ist es, mit der Menschen ohne Diagnoseerfahrung sich identifizieren, wenn sie sagen, sie seien verrückt. Diese Art ist gemeint, wenn von Genie und Wahnsinn die Rede ist. Hier wird auch der Genderaspekt von Verrücktheit klar – die Genie-Kategorie ist sehr männlich besetzt. Verrückte Männer können Genies werden, verrückte Frauen Katzenladys. Ist jemand weder Mann noch Frau und verrückt, dient die Verrücktheit zusätzlich dazu, Menschen ihr Geschlecht abzusprechen.
Die „schlimmen, anstrengenden Verrückten“: Die Menschen, die dir aufgrund ihrer Neurodiversität in der sozialen Interaktion zu anstrengend sind. Die, die du aus deinem Freundeskreis raushältst, weil sie implizite Regeln nicht befolgen. Die, von denen es sehr wichtig ist, sich abzugrenzen, wie wir aus Ratschlägen à la „get rid of negative people“ lernen können. Alles, was du dir an negativen und anstrengenden Sachen vorstellst, wenn du „psychische Diagnose“ hörst.
Fassen wir zusammen
Menschen mit psychischen Diagnosen sind am angenehmsten, wenn sie in Filmen vorkommen oder du Artikel über sie lesen kannst – Hauptsache du musst sie nicht persönlich kennenlernen.
In unserer neuesten, gedruckten Ausgabe schreiben wir zu ähnlichen Themen. Diese kannst du direkt in digitaler oder Papierform bestellen.
Von der Autorin unter dem Pseudonym „Doktor Maschinchen„, zuerst erschienen auf DoktorPeng.de
Beitragsbild: Daria Nepriakhina on Unsplash