Ist Spiritualität der Schlüssel zu einer ökologisch nachhaltigen Welt oder eine sinnlose Ablenkung, die uns weiter konsumieren und emittieren lässt? Ein Streitgespräch.
Marius Hasenheit: Klimakrise, Wegwerfgesellschaft, Artenschwund. Die Weltist voller Herausforderungen, denen wir uns sofort stellen müssen. Wenn wir zunächst auf die Erleuchtung warten, fürchte ich, könnte es für die Eisbären zu spät sein.
Jessica Böhme: Die große ökologische Krise unserer Zeit ist bloß ein Symptom. Wir können natürlich weiter an den Auswirkungen herumdoktern. Die tieferen Ursachen bleiben aber bestehen. Die Gestaltung unserer Gesellschaft fußt auf unseren inneren Einstellungen und Werten. Wenn wir eine andere Welt wollen, brauchen wir zunächst ein neues Bewusstsein für die inneren Prozesse unserer Existenz. Bei Spiritualität geht es genau darum: die inneren Prozesse anzusprechen und eine neue Perspektive einzunehmen. Spiritualität ermöglicht eine Neuordnung des Selbst, das die Beziehung zu uns, anderen und der Welt verändert.
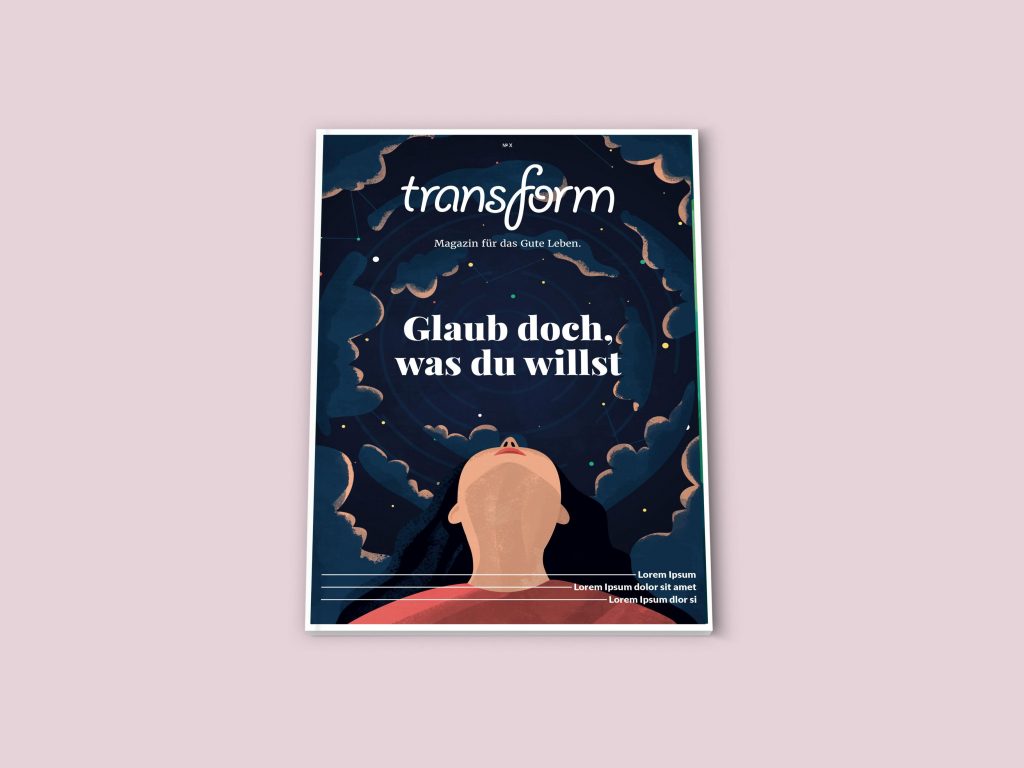
Wir Menschen sind weniger bewusst und selbstbestimmt, als wir annehmen. Oft handeln und denken wir aufgrund unterbewusster Vorgänge. Nehmen wir zum Beispiel, wie und was wir einkaufen: Forschung aus den Neurowissenschaften zeigt, dass dahinter häufig das Bedürfnis steht, sich verbunden zu fühlen. Wir shoppen als Ersatzbefriedigung. Um unser Verhalten zu verändern und ökologischer zu leben, müssen wir uns darüber bewusst werden. Wir sind ja nicht unveränderlich in die Welt geworfen. Um nachhaltig etwas zu erreichen, braucht es allgemein mehr Bewusstsein für die inneren Dimensionen der menschlichen Existenz. Das heißt auch, dass wir Spiritualität wieder in den öffentlichen und politischen Raum bringen müssen, statt im stillen Kämmerlein für uns alleine anzuwenden. Im Moment tut die Politik häufig so, als wären wir rein rationale Wesen. Doch das Modell des Homo oeconomicus wurde schon vielfach widerlegt.
Meditation: Gut für den Menschen, dem Klima egal?
Marius Hasenheit: Das sehe ich anders. Es braucht eben keine Spiritualität, um den Homo oeconomicus vom Thron zu stoßen und bewusster mit der Umwelt umzugehen. Im Gegenteil: Spiritualität ist dabei oft hinderlich. Nehmen wir das Konsumverhalten. Vor wenigen Jahren nahmen 100 Menschen im Rahmen einer Studie an einem Achtsamkeitstraining teil. Mehrere Wochen meditierten sie und tauschten sich über ihre Gefühls- und Gedankenwelt aus. Das Ergebnis? Die neuen Meditations-Fans waren mit sich und ihren Mitmenschen zufriedener. Sie hatten auch ein gesteigertes ökologisches Problembewusstsein gewonnen. Ihre Konsummuster blieben jedoch gleich – sie kauften halt nun beschwingter ein.
Wer nach Gründen sucht, warum viele Menschen glauben, alle paar Wochen ein neues Outfit zu brauchen oder sich nur im SUV sicher zu fühlen, muss sich nicht mit Spiritualität beschäftigen – Konsumpsychologie tut es auch. Schön, dass spirituelle Menschen glücklicher durchs Leben gehen – aber fürs große Ganze wird sich so nicht unbedingt etwas ändern. Während die Spirituellen total selbstzufrieden zum Yoga-Retreat nach Indien fliegen und in ihrer Meditation »ihren Beitrag« sehen, braucht es letztlich eine messbare Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der CO2-Emissionen. Daran kommen wir doch nicht vorbei. Weißt du, wie ich das meine?
Spiritualität verbindet dich mit der Welt
Jessica Böhme: Sicher, der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung, für die wir unser Verhalten massiv anpassen müssen. Aber das geht nicht mit rein oberflächlichem Pragmatismus. Es erfordert zunächst auch geistige Offenheit und die Bereitschaft, unser Leben nötigenfalls komplett umzudrehen. An dieser Stelle scheitert die ökologische Transformation ja häufig. Spiritualität kann da helfen. Für mich ist gerade das der pragmatische Ansatz. Spiritualität bedeutet nicht, dass wir uns automatisch mit der Welt verbunden fühlen und infolgedessen »richtig« handeln. Es ist ein Glaubenssystem, ein Narrativ, das wir nutzen können, um uns in der Welt zurechtzufinden. Dieses Narrativ ordnet unser Wertesystem und leitet unser Handeln.
Was wir heute häufig finden, ist eine Spiritualität des »Wellbeing«. Im Fokus steht einzig das Wohlbefinden des Einzelnen. Ich kann mich aber auch bewusst dafür entscheiden, einem Narrativ zu folgen, welches das große Ganze mit einbezieht. Der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh zum Beispiel spricht vom »Interbeing«. Der französische Philosoph Gilles Deleuze beschreibt das »Dividuum«. Die gemeinsame Idee dahinter: Wir sind alle Teil voneinander und beeinflussen uns gegenseitig. Unsere Gedanken, Worte und Ideen, sogar unsere Wünsche, Träume und die Vorstellung von uns selbst entstammen unserem sozialen Umfeld, das wiederum von der übergeordneten Gesellschaft definiert wurde. Die Gesellschaft ist in jeder einzelnen Person vorhanden.
Spiritualität kann uns in zwei Dingen helfen. Sie kann erstens dazu verhelfen, die Vogelperspektive einzunehmen. Zu erkennen, an welcher Stelle mein Handeln durch meine Vergangenheit und persönlichen Erfahrungen oder auch durch gesellschaftliche Normen geleitet werden. Das kann befreien, zum Beispiel von vermeintlichen Konsumzwängen. Zweitens kann Spiritualität helfen, zu verstehen, dass ich ein wirksamer Teil dieser komplexen Gesellschaft bin, auch wenn ich das nicht immer spüre. Die Komplexität zu erfassen, ist kognitiv gar nicht so einfach. Am liebsten möchte unser Gehirn die Welt auf ein einziges Ursache-Wirkung-Geflecht runterbrechen. Die Welt ist aber komplex. Spiritualität kann die Verbindung von persönlicher, sozialer und politischer Transformation unterstreichen.
Dekarbonisierung statt Erleuchtung!
Marius Hasenheit: Aber das Ganzheitliche zu sehen und dementsprechend bewusst zu handeln, das ist doch keine Frage der Spiritualität. Wer sich ganz auf seine Vernunft verlässt, beschränkt sich nicht automatisch auf einen bestimmten Aspekt und ignoriert alle anderen Themen. Im Gegenteil: Für nachhaltige Politik, die für alle jetzigen und zukünftigen Menschen akzeptabel ist, sind der Fokus aufs Innere und die permanente Selbstbetrachtung nur hinderlich.
Statt spirituell zu werden: Wie wäre es, unser Leben auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen im Diesseits gut zu führen und gleichzeitig eine auf Zukunft ausgerichtete Politik zu machen? Schließlich braucht es möglichst schnell sachbezogene Lösungen. So profan für manche der Kohleausstieg im Vergleich zur Erleuchtung auch klingen mag: Mir wäre der lieber.
Auch das ‚unspirituelle‘ Hirn kann Emotionen und Erfahrungen verarbeiten und muss bei weitem nicht alles in ein Ursache-Wirkung-Geflecht verpacken. Langstreckenflüge bleiben aber fürs Klimasystem auch dann schädlich, wenn sich die Passagiere sagen, dass kein gesellschaftlicher Druck sie zu der Reise zwang und, dass die Pflege ihres weitverstreuten Freundeskreises ja auch einen Einfluss auf die Welt hat. Ist es nicht zu einfach, vor Komplexität in die Spiritualität zu flüchten?
Achtsamkeit fördert das Hinterfragen des Status quo
Jessica Böhme: Es ist nicht zu einfach, denn es fördert Achtsamkeit. Diese ist notwendig, um den inneren Wandel, als ersten Schritt, überhaupt hinzukriegen. Nur wenn ich mir bewusst bin, was falsch läuft, kann ich etwas ändern. Die Alternative besteht darin, dass Politik und Gesellschaft uns das ‚normale‘ Verhalten als Standard vorgeben. Zum Beispiel: Fliegen, wann immer wir Zeit haben. Systemische Veränderung beginnt mit Hinterfragen, passiert aber nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen. Und dafür braucht es Achtsamkeit. Die Außenwelt muss dabei natürlich eine Rolle spielen. Sie wirkt auf mich ebenso wie ich auf sie. Meditation kann unser Stresslevel nachgewiesenermaßen senken, uns empathischer und verantwortungsbewusster machen. Das schafft die Basis für sinnvolles Hinterfragen.
Marius Hasenheit: Klar, wer sich auf den eigenen Atem konzentriert, driftet auch gedanklich weniger ab. Untersuchungen der TU München zeigten 2016: Atemkonzentration führt zu einer verstärkten Kontrolle der emotionalen Aktivität durch den präfrontalen Kortex, den neurologischen Sitz der Vernunft. Beim Meditieren klären sich die Gedanken, Emotionen lassen sich besser einordnen. Schreiben hat übrigens eine ganz ähnliche Wirkung. Schöner Effekt, spannendes Forschungsfeld – aber nicht zwingend ein Grund, Räucherstäbchen anzuzünden.
Die Frage ist doch vielmehr: Welche realen Folgen sind mit dem Meditieren verknüpft? Wenn durch Meditation der Konsum an Schlaftabletten reduziert oder das Anti-Aggressions-Training abgesagt werden kann: Schön! Wer sich besser fühlt oder im Alltag verträglicher wird: Nicht schlecht! Inzwischen bieten immer mehr Unternehmen Meditationskreise an – vom Digital-Konzern bis zum piefigen Mittelständler. Trotzdem wurde weder unsere Wirtschaftsweise insgesamt humaner, noch sanken die Treibhausgasemissionen. Was dabei rauskam: Alle fühlen sich besser im Hier und Jetzt. Wo aber bleibt das gemeinsame Anpacken?
Spiritualität erlaubt die gemeinsame Suche nach Antworten
Jessica Böhme: Wir sind unterschiedlich. Jeder von uns lebt in seiner eigenen Realität. Unser Umfeld, unsere Erfahrungen, all das trägt dazu bei, unser eigenes »Glaubenssystem« zu entwickeln und zu festigen. Denk das mal zu Ende: Wenn wir erwarten, dass wir gedanklich alle am gleichen Punkt landen, müssten wir dafür sorgen, dass wir alle das exakt gleiche Leben leben. Und womöglich sogar die gleichen Gene haben. Das ist unmöglich.
Die logische Alternative ist: Wir müssen in der Lage sein, die Vielfalt
unserer Geschichten anzuerkennen und fähig mit dieser Vielfalt umzugehen. Es geht also nicht darum, einander zu überzeugen und gegeneinander zu argumentieren, sondern darum, zu lernen, aufeinander einzugehen. Wir haben bisher noch keine klaren Antworten auf diese Fragen. Es ist vielmehr ein gemeinsamer Suchprozess zwischen allen. Wie schaffen wir es, in einer Welt zu leben und zufrieden nebeneinander zu leben, wenn wir nicht an unserer inneren Einstellung arbeiten?
Marius Hasenheit: Diese Frage ist für mich kein Argument für irgendwas. Auf der Suche nach »etwas zwischen Himmel und Erde« zu sein, sich »selber etwas zu suchen« mag gerade für Individualisten mit einem Hauch von Identitätskrise verlockend sein. Omas Rosenkranz tut es halt für viele nicht mehr. Doch diese Reise führt oft vom Regen in die Traufe. Die ollen, religiösen Traditionen der eigenen Vorfahren über Bord zu werfen, fühlt sich nur auf den ersten Blick frei und wild an. Heute Mantras singen, morgen das Chi suchen – spätestens wer dann Gleichgesinnte sucht, stößt wieder auf Rituale, Regeln, Meister.
Mit Spiritualität bauen sich viele ein Weltbild nach dem Wünschdirwas-Prinzip auf: Ein bisschen Buddhismus für den friedfertigen Ruf, ein wenig Hinduismus für die Farben und trendigen Symbole und irgendetwas »indianisches« noch, um die eigene Individualität zu unterstreichen. Die Religionen, die dabei als Rohstofflager dienen, werden entfremdet benutzt. Ich finde: Die Aufklärung, der Humanismus und so manche weltliche Utopie haben genug Material zum Bau eines schönen Weltbildes.
Illustration: Aelfleda Clackson für transform Magazin
Handeln
- Am Meer – eine geführte Fantasiereise: Meditative Entspannung
- Geführte Meditation: Für innere Ruhe und Stressabbau
- Anpacken, um die Welt zu verändern: Eine kleine Liste mit Tipps zur direkten Weltverbesserung
Quellen
- BiNKA, Bildung für nachhaltigen Konsum durch Achtsamkeitstraining
- Studie zu Atem, Amygdala & Stirnrinde: Mindful attention to breath regulates emotions via increased
- amygdala-prefrontal cortex connectivity, Doll, A., Hölzel, B.K., Bratec, S.M., Boucard, C., Xie, X., Wohlschläger, A., Sorg, C. (2016). NeuroImage, 134.





